WIE ICH MEINE LIEBE ZU JAMES DEAN IN DEN SAND SETZTE
cassandra, Mittwoch, 15. November 2006, 14:33
Filed under: Erinnerungen
Steven war James Dean. Schon als ich damals den Film "Rebel without a cause" sah, habe ich mich Hals über Kopf in den Schauspieler verliebt. Aber welche Frau hätte diesem verlorenen jungen Mann, der voll Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung das Leid der Welt auf seinen Schultern trug, schon wiederstehen können? Es zerriss mir das Herz, ihn nicht von der Leinwand herunterholen zu können, um ihn zu knuddeln, in meine starken Arme zu nehmen, um ihn zu retten und zu beschützen.
Steven hingegen war real. Nicht ganz so gut gebaut wie James und auch ohne fesche Tolle, aber aus Fleisch und Blut und bereit, von der Bühne der amerikanischen Highschool direkt in mein Leben gezerrt zu werden. Der Dramakurs hatte sich zu Beginn meines Austauschjahres die Inszenierung des gleichnahmigen Theaterstückes zur Aufgabe gemacht. Noch heute bin ich davon überzeugt, dass Steven dem wirklichen James Dean in der Rolle des Jim Stark die Show gestohlen hätte. Er sah nicht nur blendend aus, sondern war darüber hinaus hochbegabt. Mit einem Blick konnte er die Geschichte seiner ganzen verkorksten Jugend, seine Suche nach dem Sinn des Lebens und sein Bedürfnis nach Liebe ausdrücken. So fragil wie der Charakter, den er darstellte, war auch sein Erscheinungsbild. Strohblondes Haar, das er halblang trug, ein weiches, filigran gezeichnetes Gesicht, braune, sanfte Augen, schmale Hände und lange, feingliedrige Finger, mit denen er immer wieder durch seine Haare fuhr. Er war groß und androgyn und seine ganze Gestalt hatte etwas ätherisches, fast schon weibliches an sich, eingehüllt in eine Aura der Verletzbarkeit und Reinheit.
Ich schmolz in einem Plüschsessel dahin. Nicht nur einmal, sondern in jeder Vorstellung, die der Dramakurs gab.
Meine Erfahrungen mit dem männlichen Geschlecht begrenzten sich damals auf ein bißchen knutschen und fummeln (in Unterwäsche) mit Jungen, die mir egal waren und unerfüllte Schwämereien für Jungen, für die ich - nun ja - schwärmte. In letzterem Fall hatte meine bisherige Eroberungstaktik darin bestanden, jeglichen Kontakt mit dem Objekt meines Herzens zu meiden, allen Gesprächen durch verständnisloses Kopfschütteln auszuweichen und das Weite zu suchen, falls man sich doch zufällig über den Weg lief.
Den Jungen erschloss sich die Raffinität dieser Verführung leider nicht und so hatte ich bis zum fortgeschrittenen Alter von 18 Jahren keine echte Beziehung vorzuweisen. Mit Steven sollte sich dies nun ändern. Ich wollte ausnahmsweise meine Schüchternheit vergessen und so verbrachte ich ein Jahr mit der aktiven Eroberung seines Herzens.
Die Schwärmerei einer seiner Freunde für mich, der mich mit roten Rosen, selbstverfassten Gedichten und liebevoll zusammengestellten CDs überhäufte, nutzte ich gnadenlos aus, um in seinen Dunstkreis zu gelangen. Ich schrieb mich für die geplante neue Aufführung des Dramakurses ein und verbrachte viele einsame Stunden mit dem Bemalen und Bekleben von Bühnenbildern, musste in jeder Mittagspause eine Freundin beknien, mich zu dem kleinen Fastfoodladen ausserhalb des Campus', wo sich die Raucher immer aufhielten, zu begleiten, obwohl ich, genau wie die Freundinnen, damals noch gar nicht rauchte - tat eben alles menschenmögliche, um in seiner Nähe zu sein und ihm die Gelegenheit zu bieten, mich anzusprechen.
Ich hatte viel Zeit ihn zu beobachten. Er beschäftigte sich ausschließlich mit geistigen Dingen und verzichtete gänzlich auf die Teilnahme an den für die amerikanischen Highschools so typischen sportlichen Ertüchtigungen. Statt dessen las er viel, sang im Konzertchor der Schule und spielte leidenschaftlich gerne Theater. Geredet haben wir zwei Mal miteinander. Jeweils einen Satz.
Der Schulcampus bestand aus mehrenen kleinen Gebäuden, die den Fachrichtungen zugeordnet waren. Irgendwann bemerkte ich, dass Steven die 6. Stunde täglich in dem Gebäude verbrachte, in dem meine 5. Stunde abgehalten wurde. Daraufhin änderte ich meine Route zum anderen Gebäude, in dem meine 6. Stunde stattfand so ab - nicht ohne dabei einen beträchtlichen Umweg in Kauf zu nehmen - dass wir uns über den Weg liefen. Diese Maßnahme perfektionierte ich im Laufe der Monate. Sobald das Ende der 5. Stunde eingeläutet wurde, stürzte ich zum Fenster. Dort verharrte ich so lange, bis ich ihn beim Verlassen des gegenüberliegenden Hauses erblickte, rannte dann in Windeseile den Flur entlang und 3 Stockwerke nach unten, um ihm ganz beiläufig genau an der Tür zu treffen.
Meist war mein Timing derart perfekt, dass wir uns gegenseitig die Tür öffneten. Von Zeit zu Zeit blickte er mir dabei tief in die Augen. Ich verbrachte ganze Nächte damit, lächelnd daran zu denken, mich an diesen Blick zu erinnern, ihn zu analysieren und darin seine Gefühle für mich zu entdecken. Gegrüßt hat er mich nie.
Irgendwann hatte er dann so eine kleine, hässliche Punkfreundin mit schwarzgefärbten Zottelhaaren und schlechten Zähnen. Seltsamerweise begegneten wir uns kaum noch im Treppenhaus und obwohl ich mir wenig später die Haare schwarz färbte, schien ich mich in seiner Gegenwart in Luft aufzulösen.
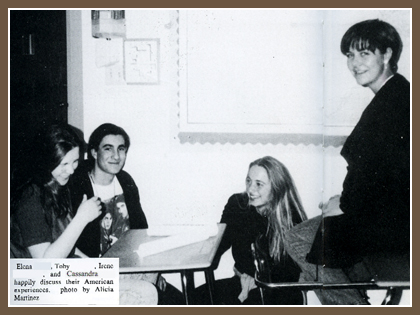
In Ermangelung eines vernünftigen Fotos von Steven hier eines von mir aus dem Jahrbuch
Zwei Jahre später kehrte ich nach Amerika zurück, um meine Gasteltern zu besuchen. Ich weiß nicht, aus welcher Motivation heraus ich zum Telefonbuch griff, um Stevens Nummer herauszusuchen. Zuhause in Deutschland wartete eine "echte" Beziehung auf mich, mit der ich meistens recht glücklich war und ich hatte in den vergangenen Jahren nicht mehr an Steven gedacht.
Aber ich war vermutlich neugierig auf meine Empfindungen meinem Highschool-Schwarm gegenüber und empfand das Bedürfnis, ihm zu gestehen, dass ich ihn ein Jahr lang aus der Ferne angebetet hatte. Bei einem Kaffee könnten wir bestimmt beide darüber lachen.
Steven hatte sich kaum verändert. Ein wenig in sich zurückgezogen, unsicher, worüber er mit mir sprechen könnte und darüber, warum ich mich mit ihm hatte treffen wollen und mit den typischen Verlegenheiten kämpfend, die ein Teenager so mit sich herum schleppt. Mir war der Altersunterschied von zwei Jahren zuvor gleichgültig gewesen, doch nun zeigte sich, dass ich als Berufstätige mit dem 12Klässler, der noch immer nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte, wenig gemeinsam hatte. Süß und beschützenswert fand ich ihn immer noch, doch von der starken früheren Anziehungkraft war nichts mehr zu spüren. Nach dem einen oder anderen Kaffee (was anderes durfte er leider nicht trinken) wurde der Abend immer entspannter. Wir lachten über gemeinsame Bekannte und irgendwann fasste ich mir ein Herz und erzählte ihm von den Gefühlen ihm gegenüber, die ich ein Jahr mit mir herumgetragen hatte. Zuerst wurde Steven ganz still. Dann zauberte er ein Lächeln auf seine Lippen und gestand mir, daß er damals in mich verliebt war. Daß er jeden Tag nach der 5. Stunde in dieses eine Gebäude lief, obwohl sein nächster Unterricht ganz woanders stattfand, nur um mir zu begegnen. Dass er sich nie getraut hat, mich anzusprechen, aus Angst vor Zurückweisung und weil sein Freund von mir schwärmte.
An diesem Abend brachte er mich nach Hause. Wir standen vor der Tür und schwiegen uns an. Und da war er wieder. Dieser Blick aus dem Treppenhaus nach der 5. Stunde. Ich überlegte, ob ich ihn küssen sollte, um wenigsten ein klein wenig für all' die verlorenen, weil nicht gemeinsam verbrachten Stunden, Wochen und Monate gutzumachen. Das Gefühl seiner Hände auf meiner Haut und seiner Lippen auf den meinen als Trost für verpasste Chancen im Leben mit nach Hause nehmen zu können.
Ich hauchte ihm einen Abschiedskuss auf die Wange, drehte mich um und ging ins Haus.
Steven hingegen war real. Nicht ganz so gut gebaut wie James und auch ohne fesche Tolle, aber aus Fleisch und Blut und bereit, von der Bühne der amerikanischen Highschool direkt in mein Leben gezerrt zu werden. Der Dramakurs hatte sich zu Beginn meines Austauschjahres die Inszenierung des gleichnahmigen Theaterstückes zur Aufgabe gemacht. Noch heute bin ich davon überzeugt, dass Steven dem wirklichen James Dean in der Rolle des Jim Stark die Show gestohlen hätte. Er sah nicht nur blendend aus, sondern war darüber hinaus hochbegabt. Mit einem Blick konnte er die Geschichte seiner ganzen verkorksten Jugend, seine Suche nach dem Sinn des Lebens und sein Bedürfnis nach Liebe ausdrücken. So fragil wie der Charakter, den er darstellte, war auch sein Erscheinungsbild. Strohblondes Haar, das er halblang trug, ein weiches, filigran gezeichnetes Gesicht, braune, sanfte Augen, schmale Hände und lange, feingliedrige Finger, mit denen er immer wieder durch seine Haare fuhr. Er war groß und androgyn und seine ganze Gestalt hatte etwas ätherisches, fast schon weibliches an sich, eingehüllt in eine Aura der Verletzbarkeit und Reinheit.
Ich schmolz in einem Plüschsessel dahin. Nicht nur einmal, sondern in jeder Vorstellung, die der Dramakurs gab.
Meine Erfahrungen mit dem männlichen Geschlecht begrenzten sich damals auf ein bißchen knutschen und fummeln (in Unterwäsche) mit Jungen, die mir egal waren und unerfüllte Schwämereien für Jungen, für die ich - nun ja - schwärmte. In letzterem Fall hatte meine bisherige Eroberungstaktik darin bestanden, jeglichen Kontakt mit dem Objekt meines Herzens zu meiden, allen Gesprächen durch verständnisloses Kopfschütteln auszuweichen und das Weite zu suchen, falls man sich doch zufällig über den Weg lief.
Den Jungen erschloss sich die Raffinität dieser Verführung leider nicht und so hatte ich bis zum fortgeschrittenen Alter von 18 Jahren keine echte Beziehung vorzuweisen. Mit Steven sollte sich dies nun ändern. Ich wollte ausnahmsweise meine Schüchternheit vergessen und so verbrachte ich ein Jahr mit der aktiven Eroberung seines Herzens.
Die Schwärmerei einer seiner Freunde für mich, der mich mit roten Rosen, selbstverfassten Gedichten und liebevoll zusammengestellten CDs überhäufte, nutzte ich gnadenlos aus, um in seinen Dunstkreis zu gelangen. Ich schrieb mich für die geplante neue Aufführung des Dramakurses ein und verbrachte viele einsame Stunden mit dem Bemalen und Bekleben von Bühnenbildern, musste in jeder Mittagspause eine Freundin beknien, mich zu dem kleinen Fastfoodladen ausserhalb des Campus', wo sich die Raucher immer aufhielten, zu begleiten, obwohl ich, genau wie die Freundinnen, damals noch gar nicht rauchte - tat eben alles menschenmögliche, um in seiner Nähe zu sein und ihm die Gelegenheit zu bieten, mich anzusprechen.
Ich hatte viel Zeit ihn zu beobachten. Er beschäftigte sich ausschließlich mit geistigen Dingen und verzichtete gänzlich auf die Teilnahme an den für die amerikanischen Highschools so typischen sportlichen Ertüchtigungen. Statt dessen las er viel, sang im Konzertchor der Schule und spielte leidenschaftlich gerne Theater. Geredet haben wir zwei Mal miteinander. Jeweils einen Satz.
Der Schulcampus bestand aus mehrenen kleinen Gebäuden, die den Fachrichtungen zugeordnet waren. Irgendwann bemerkte ich, dass Steven die 6. Stunde täglich in dem Gebäude verbrachte, in dem meine 5. Stunde abgehalten wurde. Daraufhin änderte ich meine Route zum anderen Gebäude, in dem meine 6. Stunde stattfand so ab - nicht ohne dabei einen beträchtlichen Umweg in Kauf zu nehmen - dass wir uns über den Weg liefen. Diese Maßnahme perfektionierte ich im Laufe der Monate. Sobald das Ende der 5. Stunde eingeläutet wurde, stürzte ich zum Fenster. Dort verharrte ich so lange, bis ich ihn beim Verlassen des gegenüberliegenden Hauses erblickte, rannte dann in Windeseile den Flur entlang und 3 Stockwerke nach unten, um ihm ganz beiläufig genau an der Tür zu treffen.
Meist war mein Timing derart perfekt, dass wir uns gegenseitig die Tür öffneten. Von Zeit zu Zeit blickte er mir dabei tief in die Augen. Ich verbrachte ganze Nächte damit, lächelnd daran zu denken, mich an diesen Blick zu erinnern, ihn zu analysieren und darin seine Gefühle für mich zu entdecken. Gegrüßt hat er mich nie.
Irgendwann hatte er dann so eine kleine, hässliche Punkfreundin mit schwarzgefärbten Zottelhaaren und schlechten Zähnen. Seltsamerweise begegneten wir uns kaum noch im Treppenhaus und obwohl ich mir wenig später die Haare schwarz färbte, schien ich mich in seiner Gegenwart in Luft aufzulösen.
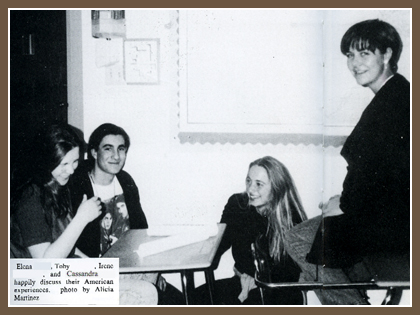
In Ermangelung eines vernünftigen Fotos von Steven hier eines von mir aus dem Jahrbuch
Zwei Jahre später kehrte ich nach Amerika zurück, um meine Gasteltern zu besuchen. Ich weiß nicht, aus welcher Motivation heraus ich zum Telefonbuch griff, um Stevens Nummer herauszusuchen. Zuhause in Deutschland wartete eine "echte" Beziehung auf mich, mit der ich meistens recht glücklich war und ich hatte in den vergangenen Jahren nicht mehr an Steven gedacht.
Aber ich war vermutlich neugierig auf meine Empfindungen meinem Highschool-Schwarm gegenüber und empfand das Bedürfnis, ihm zu gestehen, dass ich ihn ein Jahr lang aus der Ferne angebetet hatte. Bei einem Kaffee könnten wir bestimmt beide darüber lachen.
Steven hatte sich kaum verändert. Ein wenig in sich zurückgezogen, unsicher, worüber er mit mir sprechen könnte und darüber, warum ich mich mit ihm hatte treffen wollen und mit den typischen Verlegenheiten kämpfend, die ein Teenager so mit sich herum schleppt. Mir war der Altersunterschied von zwei Jahren zuvor gleichgültig gewesen, doch nun zeigte sich, dass ich als Berufstätige mit dem 12Klässler, der noch immer nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen sollte, wenig gemeinsam hatte. Süß und beschützenswert fand ich ihn immer noch, doch von der starken früheren Anziehungkraft war nichts mehr zu spüren. Nach dem einen oder anderen Kaffee (was anderes durfte er leider nicht trinken) wurde der Abend immer entspannter. Wir lachten über gemeinsame Bekannte und irgendwann fasste ich mir ein Herz und erzählte ihm von den Gefühlen ihm gegenüber, die ich ein Jahr mit mir herumgetragen hatte. Zuerst wurde Steven ganz still. Dann zauberte er ein Lächeln auf seine Lippen und gestand mir, daß er damals in mich verliebt war. Daß er jeden Tag nach der 5. Stunde in dieses eine Gebäude lief, obwohl sein nächster Unterricht ganz woanders stattfand, nur um mir zu begegnen. Dass er sich nie getraut hat, mich anzusprechen, aus Angst vor Zurückweisung und weil sein Freund von mir schwärmte.
An diesem Abend brachte er mich nach Hause. Wir standen vor der Tür und schwiegen uns an. Und da war er wieder. Dieser Blick aus dem Treppenhaus nach der 5. Stunde. Ich überlegte, ob ich ihn küssen sollte, um wenigsten ein klein wenig für all' die verlorenen, weil nicht gemeinsam verbrachten Stunden, Wochen und Monate gutzumachen. Das Gefühl seiner Hände auf meiner Haut und seiner Lippen auf den meinen als Trost für verpasste Chancen im Leben mit nach Hause nehmen zu können.
Ich hauchte ihm einen Abschiedskuss auf die Wange, drehte mich um und ging ins Haus.
Kommentare (2 Kommentare) Kommentieren
MANCHMAL MÖGEN FRAUEN EIN KLEINES BISSCHEN HAUE GERN
cassandra, Montag, 6. November 2006, 13:52
Filed under: Erinnerungen
Ich bin ja eher martialisch veranlagt und habe überhaupt kein Problem mit dem Einsatz von Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung. Selbstverständlich nur dann, wenn es gerechtfertigt ist, und z.B. ein vorwitziger BMW Fahrer einfach in die einzige frei werdene Parklücke fährt, obwohl man bereits seit fünf Minuten mit gesetztem Blinker davor steht. Einige Menschen sind halt vernünftigen Argumenten gegenüber unaufgeschlossen und das Leben ist zu kurz, sich über eine aufgetackelte und besoffene Tussi in einem Club zu ärgern, die meint, einen grundlos als Schlampe beschimpfen zu müssen.
Mein Standpunkt gegenüber körperlicher Gewalt war jedoch nicht immer derart klar definiert oder ihr Einsatz nicht immer rechtschaffend.
Eines schönen Tages spielte ich mit den Nachbarkindern auf dem Asphalt inmitten einer Plattenbausiedlung. Silvio, der Rotzlöffel aus dem dritten Stock war der Meinung, dass ihm mein rotes Dreirad viel besser zu Gesicht stünde und bemächtigte sich kurzerhand des Gefährtes. Wütend schimpfend rannte ich hinter ihm her während er seine Runden drehte. In diesem Augenblick kam mein Vater vom Einkaufen zurück und bog um die Ecke. Sobald ich ihn erblickte, tat ich dass, was die Evolution uns Weibchen seit Urgedenken einflüstert:
Ich fiel in mich zusammen und fing an zu heulen. Leider hatte der Papa zuvor beobachtet, dass ich mich auch ohne seine Hilfe zur Wehr setzen konnte und übte scharfe Kritik an meinem weibischen Habitus.
Ich musste mich auf seinen Schoss setzen und bekam eine Lektion zum Thema Konfliktlösungen durch brachiale Gewaltanwendung. Papa wollte plötzlich, dass ich ihn schlage. "Nur zu. Haue mir ins Gesicht. Richtig doll. Wenn jemand dich ärgert oder dir dein Spielzeug wegnimmt, haust du ihn einfach."
Mir ist der pädagogische Hintergrund dieser Anweisungen bis heute nicht zu voller Gänze klar geworden, aber den Worten meines Vaters konnte man eine gewisse Logik auch nicht absprechen.
Vorsichtig hauchte ich ihm einen Klapps auf die Wange. "Döller. Du kannst ruhig mit aller Kraft zuschlagen. Das tat ich dann auch und Papa war zufrieden.
Er zwang mich von da an, mit ihm gemeinsam Bud Spencer & Terence Hill Filme anzusehen und so prügelte ich mich in den folgenden Jahren mehr oder minder erfolgreich durch mein (Beziehungs-)Leben. Frauen wurden nie Ziel meiner körperlichen Attacken. Dafür kamen sie mir emotional nie nahe genug. Wenn mich jedoch ein männliches Geschöpf verbal oder durch seine Handlungen verletzte und die Tränen drohten, die Augen zu überschwemmen, überkam mich eine derartige Wut auf mich selbst und mein weibisches Rumgeheule, daß ich nur noch selber wehtun wollte.
Der Tritt zwischen die Beine oder das blaue Auge scheiterten jedoch daran, dass ich Hemmung hatte, auf Weichteile einzuschlagen, aber die Platzwunde an Christians Kopf, als ein Heizungskörper versehentlich gegen ihn rannte, weil der Achtjährige tatsächlich die Frechheit besaß zu gestehen, daß er meine beste Freundin lieber mochte als mich, konnte sich auch sehen lassen.
Mit meiner ersten großen Liebe führte ich eine physisch sehr intensive Beziehung.
Als ich aus seiner Stadt wegzog, häufte sich das Schlussmachen und Wiederzusammenkommen. Meinem ersten Gedanken, als ich ihn beim Fremdgehen erwischte, war: "in MEINER Bettwäsche, die ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe" folgte ein Schlag in sein Gesicht, der ihn filmreif drei Meter nach hinten schleuderte. Als wir zwei Stunden später wieder „zusammen waren", war seine Wange immer noch leicht gerötet.
Als wir uns im gemeinsamen Skiurlaub mal wieder stritten und er mir in einer Disko zubrüllte, ich würde doch eh' mit allen Männern meiner neuen Heimatstadt ins Bett gehen (was, obwohl es hier nichts zur Sache tut, leider nicht der Fall war), ging ich auf ihn los und der DJ unterbrach die Musik, um per Mikro den jungen Mann aufzufordern, damit aufzuhören, seine Freundin zu schlagen, obwohl er lediglich versuchte, seine Arme im Schutz vor den Ohrfeigen und mit Beseitigung des Rotweines, der sich auf seinem Hemd ergossen hatte zu koordinieren.
Am nächsten Tag reiste ich ab.
Erst als er mir eine Karte schrieb, auf der stand, dass er mich vermissen und lieben würde, dass ich ihm jedoch versprechen müsste, ihn nie wieder zu schlagen, fing ich an, mir ein paar Gedanken über meine Unfähigkeit zur verbalen Auseinandersetzung zu machen.
Geschlagen habe ich mich seitdem nur noch einmal und das lediglich für Ruhm, Ehre und Preisgeld.
Nachdem ich im Ju Jutsu die Prüfung zum orangenen Gürtel bestanden hatte, gingen die Pferde mit mir durch und ich Dummerchen prahlte wohl etwas zu laut in der Schule mit meinen Fertigkeiten, mit denen ich jeden Möchtegernvergewaltiger oder Handtaschenklauer in die Flucht schlagen könnte. Es kam zu meinem Unglück zu einem kleinen Schau-Kampf in der Turnhalle, wo ich vor versammelter Klasse gegen Jörg antrat. Wer den anderen innerhalb von 3 Minuten bezwang, hatte gewonnen, dem war die Klassenvorherrschaft, ewiger Respekt und ein Kasten Bier sicher. Ich war mir meines Sieges bewusst, handelte es sich bei Jörg doch um einen untrainierten, etwas schwach auf der Brust anmutenden, bebrillten Computernerd.
Wir standen uns gegenüber und starrten uns an. Ich versuchte, die Zuschauer auszublenden und mich einzig und allein auf meine innere Stärke zu konzentrieren. Mit einem Schulterwurf würde ich ihn binnen Sekunden von den Beinen fegen und mit einer Festhalte für die restliche Zeit bewegungslos auf die Erde nageln. Während ich ihm den Rücken zukehrte, um zum Wurf anzusetzen, nutze er seine Chance, griff um meinen Hals und riss mich nach hinten. Unter der Wucht seiner Bewegung fiel ich auf den Rücken und er wälzte sich auf mich und hielt mir beide Hände fest. Nicht einmal 30 Sekunden waren bis dahin vergangen. Nach einer weiteren halben Minute fingen die Mädchen an, mich kreischend anzufeuern, obwohl ich noch immer in der selben Position lag und versuchte, mich zu befreien. Nach eineinhalb Minuten wurde er langsam zu schwer und mir die Intimität der Situation bewusst. Nach zwei Minuten beschloss ich, auf die Etikette des orangenen Gürtels und alle guten Manieren zu verzichten und besann mich auf meine weiblichen Stärken. Ich biss ihm in die Schulter und er liess vor Schreck meine Hand los. Meine Fingernägel ratschten über seinen Rücken, aber bei Minute 2,5 hatte er sich der Hand bereits wieder bemächtigt und die restlichen 30 Sekunden verbrachte ich wild strampelnd unter seinem Gewicht.
Heute raufe ich mich nur noch zum Spaß mit dem Liebsten, ohne vorher verletzt worden zu sein, ohne Gewinnzwang (naja, stimmt nicht ganz) und unter Zuhilfenahme aller Tricks. ( Aua, auuuu. Jetzt hast du mir die Schulter ausgekugelt.... ) Meistens endet es damit, dass wir hemmungslos lachen oder ich eingeschnappt bin. Aber nicht für lange.
Mein Standpunkt gegenüber körperlicher Gewalt war jedoch nicht immer derart klar definiert oder ihr Einsatz nicht immer rechtschaffend.
Eines schönen Tages spielte ich mit den Nachbarkindern auf dem Asphalt inmitten einer Plattenbausiedlung. Silvio, der Rotzlöffel aus dem dritten Stock war der Meinung, dass ihm mein rotes Dreirad viel besser zu Gesicht stünde und bemächtigte sich kurzerhand des Gefährtes. Wütend schimpfend rannte ich hinter ihm her während er seine Runden drehte. In diesem Augenblick kam mein Vater vom Einkaufen zurück und bog um die Ecke. Sobald ich ihn erblickte, tat ich dass, was die Evolution uns Weibchen seit Urgedenken einflüstert:
Ich fiel in mich zusammen und fing an zu heulen. Leider hatte der Papa zuvor beobachtet, dass ich mich auch ohne seine Hilfe zur Wehr setzen konnte und übte scharfe Kritik an meinem weibischen Habitus.
Ich musste mich auf seinen Schoss setzen und bekam eine Lektion zum Thema Konfliktlösungen durch brachiale Gewaltanwendung. Papa wollte plötzlich, dass ich ihn schlage. "Nur zu. Haue mir ins Gesicht. Richtig doll. Wenn jemand dich ärgert oder dir dein Spielzeug wegnimmt, haust du ihn einfach."
Mir ist der pädagogische Hintergrund dieser Anweisungen bis heute nicht zu voller Gänze klar geworden, aber den Worten meines Vaters konnte man eine gewisse Logik auch nicht absprechen.
Vorsichtig hauchte ich ihm einen Klapps auf die Wange. "Döller. Du kannst ruhig mit aller Kraft zuschlagen. Das tat ich dann auch und Papa war zufrieden.
Er zwang mich von da an, mit ihm gemeinsam Bud Spencer & Terence Hill Filme anzusehen und so prügelte ich mich in den folgenden Jahren mehr oder minder erfolgreich durch mein (Beziehungs-)Leben. Frauen wurden nie Ziel meiner körperlichen Attacken. Dafür kamen sie mir emotional nie nahe genug. Wenn mich jedoch ein männliches Geschöpf verbal oder durch seine Handlungen verletzte und die Tränen drohten, die Augen zu überschwemmen, überkam mich eine derartige Wut auf mich selbst und mein weibisches Rumgeheule, daß ich nur noch selber wehtun wollte.
Der Tritt zwischen die Beine oder das blaue Auge scheiterten jedoch daran, dass ich Hemmung hatte, auf Weichteile einzuschlagen, aber die Platzwunde an Christians Kopf, als ein Heizungskörper versehentlich gegen ihn rannte, weil der Achtjährige tatsächlich die Frechheit besaß zu gestehen, daß er meine beste Freundin lieber mochte als mich, konnte sich auch sehen lassen.
Mit meiner ersten großen Liebe führte ich eine physisch sehr intensive Beziehung.
Als ich aus seiner Stadt wegzog, häufte sich das Schlussmachen und Wiederzusammenkommen. Meinem ersten Gedanken, als ich ihn beim Fremdgehen erwischte, war: "in MEINER Bettwäsche, die ich ihm zu Weihnachten geschenkt habe" folgte ein Schlag in sein Gesicht, der ihn filmreif drei Meter nach hinten schleuderte. Als wir zwei Stunden später wieder „zusammen waren", war seine Wange immer noch leicht gerötet.
Als wir uns im gemeinsamen Skiurlaub mal wieder stritten und er mir in einer Disko zubrüllte, ich würde doch eh' mit allen Männern meiner neuen Heimatstadt ins Bett gehen (was, obwohl es hier nichts zur Sache tut, leider nicht der Fall war), ging ich auf ihn los und der DJ unterbrach die Musik, um per Mikro den jungen Mann aufzufordern, damit aufzuhören, seine Freundin zu schlagen, obwohl er lediglich versuchte, seine Arme im Schutz vor den Ohrfeigen und mit Beseitigung des Rotweines, der sich auf seinem Hemd ergossen hatte zu koordinieren.
Am nächsten Tag reiste ich ab.
Erst als er mir eine Karte schrieb, auf der stand, dass er mich vermissen und lieben würde, dass ich ihm jedoch versprechen müsste, ihn nie wieder zu schlagen, fing ich an, mir ein paar Gedanken über meine Unfähigkeit zur verbalen Auseinandersetzung zu machen.
Geschlagen habe ich mich seitdem nur noch einmal und das lediglich für Ruhm, Ehre und Preisgeld.
Nachdem ich im Ju Jutsu die Prüfung zum orangenen Gürtel bestanden hatte, gingen die Pferde mit mir durch und ich Dummerchen prahlte wohl etwas zu laut in der Schule mit meinen Fertigkeiten, mit denen ich jeden Möchtegernvergewaltiger oder Handtaschenklauer in die Flucht schlagen könnte. Es kam zu meinem Unglück zu einem kleinen Schau-Kampf in der Turnhalle, wo ich vor versammelter Klasse gegen Jörg antrat. Wer den anderen innerhalb von 3 Minuten bezwang, hatte gewonnen, dem war die Klassenvorherrschaft, ewiger Respekt und ein Kasten Bier sicher. Ich war mir meines Sieges bewusst, handelte es sich bei Jörg doch um einen untrainierten, etwas schwach auf der Brust anmutenden, bebrillten Computernerd.
Wir standen uns gegenüber und starrten uns an. Ich versuchte, die Zuschauer auszublenden und mich einzig und allein auf meine innere Stärke zu konzentrieren. Mit einem Schulterwurf würde ich ihn binnen Sekunden von den Beinen fegen und mit einer Festhalte für die restliche Zeit bewegungslos auf die Erde nageln. Während ich ihm den Rücken zukehrte, um zum Wurf anzusetzen, nutze er seine Chance, griff um meinen Hals und riss mich nach hinten. Unter der Wucht seiner Bewegung fiel ich auf den Rücken und er wälzte sich auf mich und hielt mir beide Hände fest. Nicht einmal 30 Sekunden waren bis dahin vergangen. Nach einer weiteren halben Minute fingen die Mädchen an, mich kreischend anzufeuern, obwohl ich noch immer in der selben Position lag und versuchte, mich zu befreien. Nach eineinhalb Minuten wurde er langsam zu schwer und mir die Intimität der Situation bewusst. Nach zwei Minuten beschloss ich, auf die Etikette des orangenen Gürtels und alle guten Manieren zu verzichten und besann mich auf meine weiblichen Stärken. Ich biss ihm in die Schulter und er liess vor Schreck meine Hand los. Meine Fingernägel ratschten über seinen Rücken, aber bei Minute 2,5 hatte er sich der Hand bereits wieder bemächtigt und die restlichen 30 Sekunden verbrachte ich wild strampelnd unter seinem Gewicht.
Heute raufe ich mich nur noch zum Spaß mit dem Liebsten, ohne vorher verletzt worden zu sein, ohne Gewinnzwang (naja, stimmt nicht ganz) und unter Zuhilfenahme aller Tricks. ( Aua, auuuu. Jetzt hast du mir die Schulter ausgekugelt.... ) Meistens endet es damit, dass wir hemmungslos lachen oder ich eingeschnappt bin. Aber nicht für lange.
Kommentare (0 Kommentare) Kommentieren
KATZENBLOGGEN
ODER WIE ICH MAL EIN HAUFEN BABYS AUF DIE WELT BRACHTE
ODER WIE ICH MAL EIN HAUFEN BABYS AUF DIE WELT BRACHTE
cassandra, Donnerstag, 2. November 2006, 11:03
Filed under: Erinnerungen
Berta und Heinz-Egon gehörten nicht wirklich meinen Eltern. Das Herrchen des Geschwisterpärchens war ein einbeiniger Säufer, der nebenan lebte. Da er oft wochenlang von der Erdoberfläche verschollen war, um vermutlich seinen Rausch auszuschlafen, wurden die beiden von meinen Eltern adoptiert, die sie mit Speis und Trank auf ihrem Hof versorgten.

Keine Ahnung, ob es im Umfeld des Dorfes keine anderen Kater gab, die Berta als würdig empfand, sie zum Zwecke der Erweiterung des Genpools zu schwängern, sie entschied sich für ihren Bruder Heinz-Egon. Das war wohl nicht nur auf Grund des Verwandtschaftsgrades am Rande der Legalität, sondern auch, weil beide noch minderjährig waren.
Berta, selbst noch nicht ganz ausgewachsen, kam mit ihrer Schwangerschaft nicht wirklich klar und bekam eines Tages wohl deshalb - ganz katzenuntypisch - ausgerechnet mitten auf dem Wohnzimmerteppich meiner Eltern ihre Wehen.
Da ich zufällig just an diesem Abend zu Besuch weilte, musste ich als Geburtshelfer einspringen.
Sie zitterte am ganzen Leib und geriet immer wieder in Panik, weil sie nicht so recht verstand, was da vor sich ging und ich streichelte ihr stundenlang den Bauch, bis sich das erste kleine Köpfchen endlich zeigte. Nachdem das erste kleine Fellknäul das Licht der Welt erblickt hatte (nunja, falls man diesen Ausdruck bei geschlossenen Augen überhaupt verwenden darf) ging es zügig weiter. Berta war hoffnungslos überfordert mit der Situation, sich um bereits geworfenen und sich im Wurf befindlichen Nachwuchs zu kümmern und drohte immer wieder, sich aus Versehen des selbigen durch Draufwälzen zu entledigen. Ich nahm die Kleinen beiseite, um sie zu wärmen und abzutupfen, doch nach 4 kleinen Bälgern gegen 4 Uhr morgen schien das schlimmste überstanden und ich wankte todmüde, aber glücklich zu Bett.
Am nächsten Morgen zeigte sich, dass sie noch zwei weitere bekommen hatte, von denen eines jedoch bewegungslos und ohne erkennbare Lebenszeichnen am Rand der Decke lag.
Mir selbst Vorwürfe machend, weil meine Bequemlichkeit den Tod eines der unschuldigen Geschöpfe verursacht hatte, fuhr ich schweren Herzens an jenem Tag nach Hamburg zu einer Kundenabnahme. Auf der Fahrt rief mich plötzlich meine Mutter an. Kleinlaut druckste sie ein wenig herum und ich ahnte, daß etwas mit meinen Schützlingen nicht stimmte. Nachdem sie eine Weile um den heissen Brei herumgeredet und mir lang und breit erklärte hatte, dass sie unmöglich so viele Katzen auf dem Hof behalten könnten, da sie zum einen gar nicht ihnen gehörten und zum anderen meine Eltern nur am Wochenende daheim waren und bisher immer eine Nachbarin zum Füttern bemüht hatten, rückte sie mit der Wahrheit heraus: sobald ich losgefahren war, hatten sie selbige Nachbarin herübergebeten, um meinen Nachwuchs im nahe gelegenen See zu ertränken.
Für den Rest des Tages war ich für nichts mehr zu gebrauchen. Meine Kunden versuchten, peinlich berührt darüber hinwegzusehen, dass mir immer wieder die Tränen in die Augen stiegen, aber Verständnis hatte keiner so richtig. Im Grunde genommen handelte es sich ja nur um Katzen und die Erfahrung, bei der Entstehung von Leben so hautnah dabei zu sein, konnte keiner so recht teilen.
Eines der kleinen hatte die grausame Nachbarin verschont. Ein kleiner Rotschopf, den meine Eltern mir zu Ehren Boris tauften (da ich damals gerade einen Werbespot mit einem ehemaligen Sportler mit diesem Namen gedreht hatte).
Boris war ein Sonnenschein und ich musste jedes Mal bei Besuchen harte Kämpfe mit mir und meinen Eltern durchstehen, weil ich ihn am liebsten eingepackt und mitgenommen hätte. Er liebte den Hund meiner Eltern und liess sich von ihm immer ins Maul nehmen und herumschleudern, um Karussell zu spielen.
Auch ein paar Wochen später stellte meine Mutter mich vor vollendete Tatsachen, als sie mir telefonisch mitteilte, dass sie ihn weggegeben hatten. Nun wohnt er in Bremen und schickt uns jedes Jahr um Weihnachten herum ein Foto. Riesig und elegant ist er geworden. Wenn ich die Fotos so ansehe, werde ich immer ein wenig traurig, dass ich ihn damals nicht einfach mitgenommen habe. Ihn und seine Geschwister. Aber man wirkt ja ein wenig schrullig, wenn man mehr als zwei Katzen hat.

Keine Ahnung, ob es im Umfeld des Dorfes keine anderen Kater gab, die Berta als würdig empfand, sie zum Zwecke der Erweiterung des Genpools zu schwängern, sie entschied sich für ihren Bruder Heinz-Egon. Das war wohl nicht nur auf Grund des Verwandtschaftsgrades am Rande der Legalität, sondern auch, weil beide noch minderjährig waren.
Berta, selbst noch nicht ganz ausgewachsen, kam mit ihrer Schwangerschaft nicht wirklich klar und bekam eines Tages wohl deshalb - ganz katzenuntypisch - ausgerechnet mitten auf dem Wohnzimmerteppich meiner Eltern ihre Wehen.
Da ich zufällig just an diesem Abend zu Besuch weilte, musste ich als Geburtshelfer einspringen.
Sie zitterte am ganzen Leib und geriet immer wieder in Panik, weil sie nicht so recht verstand, was da vor sich ging und ich streichelte ihr stundenlang den Bauch, bis sich das erste kleine Köpfchen endlich zeigte. Nachdem das erste kleine Fellknäul das Licht der Welt erblickt hatte (nunja, falls man diesen Ausdruck bei geschlossenen Augen überhaupt verwenden darf) ging es zügig weiter. Berta war hoffnungslos überfordert mit der Situation, sich um bereits geworfenen und sich im Wurf befindlichen Nachwuchs zu kümmern und drohte immer wieder, sich aus Versehen des selbigen durch Draufwälzen zu entledigen. Ich nahm die Kleinen beiseite, um sie zu wärmen und abzutupfen, doch nach 4 kleinen Bälgern gegen 4 Uhr morgen schien das schlimmste überstanden und ich wankte todmüde, aber glücklich zu Bett.
Am nächsten Morgen zeigte sich, dass sie noch zwei weitere bekommen hatte, von denen eines jedoch bewegungslos und ohne erkennbare Lebenszeichnen am Rand der Decke lag.
Mir selbst Vorwürfe machend, weil meine Bequemlichkeit den Tod eines der unschuldigen Geschöpfe verursacht hatte, fuhr ich schweren Herzens an jenem Tag nach Hamburg zu einer Kundenabnahme. Auf der Fahrt rief mich plötzlich meine Mutter an. Kleinlaut druckste sie ein wenig herum und ich ahnte, daß etwas mit meinen Schützlingen nicht stimmte. Nachdem sie eine Weile um den heissen Brei herumgeredet und mir lang und breit erklärte hatte, dass sie unmöglich so viele Katzen auf dem Hof behalten könnten, da sie zum einen gar nicht ihnen gehörten und zum anderen meine Eltern nur am Wochenende daheim waren und bisher immer eine Nachbarin zum Füttern bemüht hatten, rückte sie mit der Wahrheit heraus: sobald ich losgefahren war, hatten sie selbige Nachbarin herübergebeten, um meinen Nachwuchs im nahe gelegenen See zu ertränken.
Für den Rest des Tages war ich für nichts mehr zu gebrauchen. Meine Kunden versuchten, peinlich berührt darüber hinwegzusehen, dass mir immer wieder die Tränen in die Augen stiegen, aber Verständnis hatte keiner so richtig. Im Grunde genommen handelte es sich ja nur um Katzen und die Erfahrung, bei der Entstehung von Leben so hautnah dabei zu sein, konnte keiner so recht teilen.
Eines der kleinen hatte die grausame Nachbarin verschont. Ein kleiner Rotschopf, den meine Eltern mir zu Ehren Boris tauften (da ich damals gerade einen Werbespot mit einem ehemaligen Sportler mit diesem Namen gedreht hatte).
Boris war ein Sonnenschein und ich musste jedes Mal bei Besuchen harte Kämpfe mit mir und meinen Eltern durchstehen, weil ich ihn am liebsten eingepackt und mitgenommen hätte. Er liebte den Hund meiner Eltern und liess sich von ihm immer ins Maul nehmen und herumschleudern, um Karussell zu spielen.
Auch ein paar Wochen später stellte meine Mutter mich vor vollendete Tatsachen, als sie mir telefonisch mitteilte, dass sie ihn weggegeben hatten. Nun wohnt er in Bremen und schickt uns jedes Jahr um Weihnachten herum ein Foto. Riesig und elegant ist er geworden. Wenn ich die Fotos so ansehe, werde ich immer ein wenig traurig, dass ich ihn damals nicht einfach mitgenommen habe. Ihn und seine Geschwister. Aber man wirkt ja ein wenig schrullig, wenn man mehr als zwei Katzen hat.
Kommentare (1 Kommentar) Kommentieren
TOUR DE AFRIQUE DU SUD
cassandra, Dienstag, 4. Juli 2006, 17:57
Filed under: Erinnerungen
Meinem herzallerliebsten Chef und seinen unzähligen Meilen habe ich es zu verdanken, zweimal in meinem Leben Langstreckenflüge in der ersten Klasse verbracht zu haben.
Das erste Mal schenkte er mir ein Update zu Weihnachten, als wir am 23.12. von einem Südafrika-Dreh in die Heimat zurückkehrten.
Das Glück war mir gleich zweifach hold und platzierte mich fern von Kunden direkt neben einen mir unbekannten End-Zwanziger. Der Blondschopf schien einem Hochglanzcover-Fotoshooting an den Ufern des Atlantik entsprungen. Feingeschnittene Gesichtszüge, tiefblaue Augen und ein Körper bei derem Anblick selbst meine Mutter ein fröhliches Hallelujah auf dem Akkordeon angestimmt hätte. Er hatte eine angenehme Stimme und ein Lächeln, das mich sofort in die Rolle eines vorpubertären, anhimmelnden Mädchen zurückversetzte.
Das Model stellte sich in bälde jedoch als deutscher Radprofi, der gerade von einem Training des Telekom-Teams in den afrikanischen Bergen heimkehrte, vor. Die nächsten Stunden verbrachten wir gemeinsam Wein trinkend, plaudernd und nebeneinander schlafend. Zumindest letzteres fiel mir nicht sonderlich leicht, musste ich die Zeit doch nutzen, meine Zukunft mit dem Supermodelradrennfahrer zu planen.
In den frühen Morgenstunden saß ich bereits wieder aufrecht, den Tisch aufgeklappt, die Serviette gefaltet und wartete sehnsüchtig auf meine nächste Mahlzeit. Die Flugbegleiterin reichte mir mein Rührei und zeigte dann auf meinen schlafenden Nachbarn: "Möchte ihr Mann auch frühstücken?"
Ich strahlte über das ganze Gesicht und meinte mit stolz geschwellter Brust: Nein. Lassen sie ihn lieber noch etwas schlafen. Er ist ein richtiger Morgenmuffel und hat immer fürchterlich schlechte Laune, wenn man ihn zu früh weckt.
Die Google-Suche zu Hause nach dem Vater meiner zukünftigen Kinder war dann eher enttäuschend, da mein Sitznachbar eher unter ferner liefen im Telekom Team mitfuhr.
Nun musste ich wieder an ihn denken.
2006 wird hoffentlich sein Jahr und vielleicht besteht ja noch eine klitzekleine Chance für mich, einen Supermodel-Tour-de-France-Gewinner zu ehelichen.
Das erste Mal schenkte er mir ein Update zu Weihnachten, als wir am 23.12. von einem Südafrika-Dreh in die Heimat zurückkehrten.
Das Glück war mir gleich zweifach hold und platzierte mich fern von Kunden direkt neben einen mir unbekannten End-Zwanziger. Der Blondschopf schien einem Hochglanzcover-Fotoshooting an den Ufern des Atlantik entsprungen. Feingeschnittene Gesichtszüge, tiefblaue Augen und ein Körper bei derem Anblick selbst meine Mutter ein fröhliches Hallelujah auf dem Akkordeon angestimmt hätte. Er hatte eine angenehme Stimme und ein Lächeln, das mich sofort in die Rolle eines vorpubertären, anhimmelnden Mädchen zurückversetzte.
Das Model stellte sich in bälde jedoch als deutscher Radprofi, der gerade von einem Training des Telekom-Teams in den afrikanischen Bergen heimkehrte, vor. Die nächsten Stunden verbrachten wir gemeinsam Wein trinkend, plaudernd und nebeneinander schlafend. Zumindest letzteres fiel mir nicht sonderlich leicht, musste ich die Zeit doch nutzen, meine Zukunft mit dem Supermodelradrennfahrer zu planen.
In den frühen Morgenstunden saß ich bereits wieder aufrecht, den Tisch aufgeklappt, die Serviette gefaltet und wartete sehnsüchtig auf meine nächste Mahlzeit. Die Flugbegleiterin reichte mir mein Rührei und zeigte dann auf meinen schlafenden Nachbarn: "Möchte ihr Mann auch frühstücken?"
Ich strahlte über das ganze Gesicht und meinte mit stolz geschwellter Brust: Nein. Lassen sie ihn lieber noch etwas schlafen. Er ist ein richtiger Morgenmuffel und hat immer fürchterlich schlechte Laune, wenn man ihn zu früh weckt.
Die Google-Suche zu Hause nach dem Vater meiner zukünftigen Kinder war dann eher enttäuschend, da mein Sitznachbar eher unter ferner liefen im Telekom Team mitfuhr.
Nun musste ich wieder an ihn denken.
2006 wird hoffentlich sein Jahr und vielleicht besteht ja noch eine klitzekleine Chance für mich, einen Supermodel-Tour-de-France-Gewinner zu ehelichen.
Kommentare (4 Kommentare) Kommentieren
SUCHBILD
cassandra, Mittwoch, 19. April 2006, 20:48
Filed under: Erinnerungen
Gestern habe ich nun endlich die letzten beiden Umzugskartons ausgeräumt.
Kurz vor der Lesung hatte ich bereits meine Mutter gebeten, den heimischen Dachboden auf der Suche nach dem Foto, dass zu der geplanten Foltergeschichte gehört, zu durchforsten. Leider erfolglos. Das Bild befand sich nämlich in einem Karton, der seit fast einem Jahr in meinem Wohnzimmer im Weg stand.
Ich möchte mein Glück über den Fund natürlich niemandem vorenthalten.
Falls jemand raten möchte, wer ich bin, sollte er erst einen Tipp abgeben und dann die Geschichte lesen.

Kurz vor der Lesung hatte ich bereits meine Mutter gebeten, den heimischen Dachboden auf der Suche nach dem Foto, dass zu der geplanten Foltergeschichte gehört, zu durchforsten. Leider erfolglos. Das Bild befand sich nämlich in einem Karton, der seit fast einem Jahr in meinem Wohnzimmer im Weg stand.
Ich möchte mein Glück über den Fund natürlich niemandem vorenthalten.
Falls jemand raten möchte, wer ich bin, sollte er erst einen Tipp abgeben und dann die Geschichte lesen.

Kommentare (16 Kommentare) Kommentieren
ALS ICH MIT FRANCESCA AN DER STANGE TANZTE UND WARUM MICH MEIN CHEF NOCH HEUTE AUSLACHT
cassandra, Dienstag, 12. Juli 2005, 15:51
Filed under: Erinnerungen
Mein erstes Mal erlebte ich nach stundenwährendem Schlendern von Bierzelt zu Bierzelt auf der alljährlichen Kirmes, einigen gruseligen Kneipen und rauschenden Tänzen in vollverspiegelten Diskotheken mit Teppichböden in Gesellschaft einer Freundin, die gerade als freie Assistentin in unserer Firma arbeitete.
Es war ihr zweiter Tag und sie war sehr angetan von der Geselligkeit der Kollegen. Wie alle anderen hatte sie keine Lust, angeheitert um 4 Uhr morgens ins Bett zu gehen. Die Auswahl an Lokalitäten um diese Zeit unter der Woche tendierte jedoch gegen nicht vorhanden und daher schlug jemand den Besuch eines Puffs vor.
An der ersten Tür wurden wir auf Grund der hohen Frauenquote abgewiesen. Praktischerweise lag das nächste Etablissement gleich nebenan. Nachdem unser Chef dem Türsteher eine nicht mehr nachvollziehbare Anzahl Geldscheine in die Hand gedrückt hatte, durften wir das Tor zu den heiligen Hallen passieren.
Drinnen erwartete uns eine Art vergüldete Plüsch-Spiegel-gedämpftes-Licht Lokalität mit einer großen Bar in der Mitte. Um die Bar waren kleine, komplett verspiegelte Nischen in die Wände eingelassen, in deren Mitte sich jeweils eine Stange befand. Am Rand der Nischen waren Sitzbänke angeordnet, auf denen junge, gelangweilte Damen sassen. Wir waren nicht die einzigen Besucher in jener Nacht, doch unsere Anwesenheit vertrieb die zwei Herren binnen weniger Minuten.
Wir nahmen die Bar in Beschlag und tranken sündhaft teuren Champagner.
Zurückblickend würde ich sagen, dass mein Chef versuchte, mich zu provozieren, doch an jenem Abend fand ich mich in Kürze mitten in einer angeregten Diskussion über meine berufliche Zukunft wieder. Damals haben wir des öfteren meine Pläne analysiert, einmal Regisseurin zu werden. Mein Chef war der Meinung, dass ich auf Grund meiner Persönlichkeit eine verdammt schlechte abgeben würde. Er war der Meinung, dass ich eine unzureichende Beobachtungsgabe hätte und nicht in der Lage wäre, mich mit fremden Menschen auseinander zu setzen.
Als Beispiel für seine Ausführungen machte er mich auf die anwesenden firmenexternen Damen aufmerksam. Er stellte die Prognose auf, dass ich nicht in der Lage wäre, mich mit einer von ihnen vernünftig zu unterhalten. Das wollte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Selbstverständlich war ich in der Lage, mich als potentielle Dokumentarfilmerin zu betätigen, mich meinem Umfeld anzupassen und einer professionell tätigen Dame ihre schwärzesten Geheimnisse zu entlocken.
Schnurstracks maschierte ich auf die hübscheste zu und fragte sie nach ihrem Namen. Die vollbusige 20jährige mit den blonden Locken hiess Francesca. Ich musste unwillkürlich grinsen und stellte mich als Angelique vor. Francesca versuchte, meinen investigativen Fragen zu entkommen und schob ihre Arbeit vor.
Sie erhob sich und begab sich in eine der Nischen, um sich an einer der dort befindlichen Stangen laszive Verrenkungen zu exerzieren. So leicht lässt sich eine Dokumentarfilmerin jedoch nicht abschütteln. Ich folgte ihr und fragte, ob sie etwas dagegen hätte, wenn ich ihr Gesellschaft leisten würde. Da sie keine Einwände hatte, umgriff ich die Stange mit beiden Händen und schaukelte ein wenig zum Takt der Musik während ich sie interviewte. Sie erzählte mir, dass sie nach der Schule keinen Job gefunden hat und auch nicht mehr weitergesucht habe, nachdem ihr eine Freundin den Hinweis gab, sich hier zu bewerben. Die Arbeit mache meistens Spaß, wäre gut bezahlt und sie dürfe sich aussuchen, ob sie mit auf’s Zimmer gehen wolle oder nicht.
Bei dem Wort „Zimmer“ wurde ich hellhörig. Auf meinen Wunsch hin gab sie mir eine Führung durch’s Haus. Die Räume waren alle gleich ausgestattet. Blümchentapete an den Wänden, billige, in die Decke eingelassene Strahler, die ein unromantischesbarmherziges Licht absonderten, ein großes Bett mit einem Überwurf, den ein Versandhausdesigner im Drogenrausch entworfen haben musste und in der Mitte eines jeden Zimmers ein Whirlpool. Am Wannenrand standen zwei Spraydosen. Eine mit Sprühsahne und eine mit Badreiniger. Reinlichkeit war offensichtlich oberstes Gebot im Hause.
Als wir gegen 7 Uhr die Örtlichkeit verliessen, begleitete uns der Herr des Hauses bis an die Tür. Auf Grund meines neugewonnenen Selbstbewusstseins als angehende Regisseurin baute ich mich vor ihm auf und fragte, ob er mir einen Job geben würde. Er musterte mich von oben bis unten und antwortete, ohne das Gesicht zu verziehen: Nein.
Nun, wenn man seine Grenzen nicht kennt, muss man manchmal mit dem Kinn direkt hinein geschmettert werden.
In den folgenden Tagen erzählte mein Chef jedem, der es hören oder eben nicht hören wollte, dass ich beim Tanzen an der Stange wie ein Besen aussehen würde. Auch heute gelingt es ihm, steife Geschäftsessen mit dieser Anekdote aufzulockern. Mein Protest und der Hinweis auf mein Interview, dass rein gar nichts mit Tanzen zu tun hatte, sondern lediglich mit der Suche nach Informationen und Halt (angesichts der alkoholgetränkten physischen Kondition) wird stets überhört.
Ein halbes Jahr später klingelte mein Telefon in der Firma. Eine Frau war am Apparat. Sie stellte sich als Frau Krause aus der xy-Straße Nummer 96 vor. Ihre Stimme klang geschäftlich und sie erwähnte, ein Vorstellungsgespräch vor einigen Monaten in ihrer Firma. Ob ich immer noch Interesse hätte. Den Namen der Straße assoziiere ich nur mit einer Geschichte und ich erstarrte. „Woher haben Sie meine Nummer?“ hauchte ich in den Hörer. „Sie haben uns ihre Visitenkarte hiergelassen.“
Oh mein Gott. Offensichtlich war ich damals doch betrunkener, als ich es in Erinnerung hatte. Sie wollte wissen, ob ich schon Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hätte. „Na. Das übliche halt. Aber eigentlich..." Sie unterbrach mich. Ihr Geschäftsführer hätte ihr von meinem Tanz mit einer ihrer Angestellten erzählt und es habe ganz “ordentlich“ ausgesehen. Na bitteschön. Ich sehe nicht aus wie ein Besen. Meinem Chef werde ich es schon noch zeigen. „Wieviel zahlen Sie denn?“ Diese Information hatte mir Francesca leider verschwiegen. “Das kommt ganz drauf an. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn Sie noch einmal zu einem Eignungstest vorbeikommen würden. Dann können wir uns auch über die Formalitäten unterhalten.“ Ich geriet ins Schwitzen. Eine Fortsetzung meiner Dokumentation könnte unter Umständen auch für mich von Vorteil sein. Immerhin belebt Konkurrenz ja bekanntlich das Geschäft und vielleicht beinhaltete diese Geschichte ja Potential für eine Gehaltsverhandlung mit meinem Chef. “Ich habe aber gehört, dass ich mir meine – ähhh – Geschäftspartner aussuchen kann“
In diesem Moment fing die Dame am anderen Ende an, lauthals zu lachen. Meine lieben Kolleginnen kamen um die Ecke und stimmten, ein Telefon am Ohr, in das Gelächter ein. Mittlerweile ging mir ein Licht auf und ich erkannte meine Freundin, die damals ihren zweiten Arbeitstag in unserer Gesellschaft verbracht hatte an dem glucksenden, nach Luft ringenden Röcheln.
Morgen geht es weiter mit „Wie mir Juliette ihre Ohrringe schenkte“.
Es war ihr zweiter Tag und sie war sehr angetan von der Geselligkeit der Kollegen. Wie alle anderen hatte sie keine Lust, angeheitert um 4 Uhr morgens ins Bett zu gehen. Die Auswahl an Lokalitäten um diese Zeit unter der Woche tendierte jedoch gegen nicht vorhanden und daher schlug jemand den Besuch eines Puffs vor.
An der ersten Tür wurden wir auf Grund der hohen Frauenquote abgewiesen. Praktischerweise lag das nächste Etablissement gleich nebenan. Nachdem unser Chef dem Türsteher eine nicht mehr nachvollziehbare Anzahl Geldscheine in die Hand gedrückt hatte, durften wir das Tor zu den heiligen Hallen passieren.
Drinnen erwartete uns eine Art vergüldete Plüsch-Spiegel-gedämpftes-Licht Lokalität mit einer großen Bar in der Mitte. Um die Bar waren kleine, komplett verspiegelte Nischen in die Wände eingelassen, in deren Mitte sich jeweils eine Stange befand. Am Rand der Nischen waren Sitzbänke angeordnet, auf denen junge, gelangweilte Damen sassen. Wir waren nicht die einzigen Besucher in jener Nacht, doch unsere Anwesenheit vertrieb die zwei Herren binnen weniger Minuten.
Wir nahmen die Bar in Beschlag und tranken sündhaft teuren Champagner.
Zurückblickend würde ich sagen, dass mein Chef versuchte, mich zu provozieren, doch an jenem Abend fand ich mich in Kürze mitten in einer angeregten Diskussion über meine berufliche Zukunft wieder. Damals haben wir des öfteren meine Pläne analysiert, einmal Regisseurin zu werden. Mein Chef war der Meinung, dass ich auf Grund meiner Persönlichkeit eine verdammt schlechte abgeben würde. Er war der Meinung, dass ich eine unzureichende Beobachtungsgabe hätte und nicht in der Lage wäre, mich mit fremden Menschen auseinander zu setzen.
Als Beispiel für seine Ausführungen machte er mich auf die anwesenden firmenexternen Damen aufmerksam. Er stellte die Prognose auf, dass ich nicht in der Lage wäre, mich mit einer von ihnen vernünftig zu unterhalten. Das wollte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Selbstverständlich war ich in der Lage, mich als potentielle Dokumentarfilmerin zu betätigen, mich meinem Umfeld anzupassen und einer professionell tätigen Dame ihre schwärzesten Geheimnisse zu entlocken.
Schnurstracks maschierte ich auf die hübscheste zu und fragte sie nach ihrem Namen. Die vollbusige 20jährige mit den blonden Locken hiess Francesca. Ich musste unwillkürlich grinsen und stellte mich als Angelique vor. Francesca versuchte, meinen investigativen Fragen zu entkommen und schob ihre Arbeit vor.
Sie erhob sich und begab sich in eine der Nischen, um sich an einer der dort befindlichen Stangen laszive Verrenkungen zu exerzieren. So leicht lässt sich eine Dokumentarfilmerin jedoch nicht abschütteln. Ich folgte ihr und fragte, ob sie etwas dagegen hätte, wenn ich ihr Gesellschaft leisten würde. Da sie keine Einwände hatte, umgriff ich die Stange mit beiden Händen und schaukelte ein wenig zum Takt der Musik während ich sie interviewte. Sie erzählte mir, dass sie nach der Schule keinen Job gefunden hat und auch nicht mehr weitergesucht habe, nachdem ihr eine Freundin den Hinweis gab, sich hier zu bewerben. Die Arbeit mache meistens Spaß, wäre gut bezahlt und sie dürfe sich aussuchen, ob sie mit auf’s Zimmer gehen wolle oder nicht.
Bei dem Wort „Zimmer“ wurde ich hellhörig. Auf meinen Wunsch hin gab sie mir eine Führung durch’s Haus. Die Räume waren alle gleich ausgestattet. Blümchentapete an den Wänden, billige, in die Decke eingelassene Strahler, die ein un
Als wir gegen 7 Uhr die Örtlichkeit verliessen, begleitete uns der Herr des Hauses bis an die Tür. Auf Grund meines neugewonnenen Selbstbewusstseins als angehende Regisseurin baute ich mich vor ihm auf und fragte, ob er mir einen Job geben würde. Er musterte mich von oben bis unten und antwortete, ohne das Gesicht zu verziehen: Nein.
Nun, wenn man seine Grenzen nicht kennt, muss man manchmal mit dem Kinn direkt hinein geschmettert werden.
In den folgenden Tagen erzählte mein Chef jedem, der es hören oder eben nicht hören wollte, dass ich beim Tanzen an der Stange wie ein Besen aussehen würde. Auch heute gelingt es ihm, steife Geschäftsessen mit dieser Anekdote aufzulockern. Mein Protest und der Hinweis auf mein Interview, dass rein gar nichts mit Tanzen zu tun hatte, sondern lediglich mit der Suche nach Informationen und Halt (angesichts der alkoholgetränkten physischen Kondition) wird stets überhört.
Ein halbes Jahr später klingelte mein Telefon in der Firma. Eine Frau war am Apparat. Sie stellte sich als Frau Krause aus der xy-Straße Nummer 96 vor. Ihre Stimme klang geschäftlich und sie erwähnte, ein Vorstellungsgespräch vor einigen Monaten in ihrer Firma. Ob ich immer noch Interesse hätte. Den Namen der Straße assoziiere ich nur mit einer Geschichte und ich erstarrte. „Woher haben Sie meine Nummer?“ hauchte ich in den Hörer. „Sie haben uns ihre Visitenkarte hiergelassen.“
Oh mein Gott. Offensichtlich war ich damals doch betrunkener, als ich es in Erinnerung hatte. Sie wollte wissen, ob ich schon Erfahrungen in dem Bereich gesammelt hätte. „Na. Das übliche halt. Aber eigentlich..." Sie unterbrach mich. Ihr Geschäftsführer hätte ihr von meinem Tanz mit einer ihrer Angestellten erzählt und es habe ganz “ordentlich“ ausgesehen. Na bitteschön. Ich sehe nicht aus wie ein Besen. Meinem Chef werde ich es schon noch zeigen. „Wieviel zahlen Sie denn?“ Diese Information hatte mir Francesca leider verschwiegen. “Das kommt ganz drauf an. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn Sie noch einmal zu einem Eignungstest vorbeikommen würden. Dann können wir uns auch über die Formalitäten unterhalten.“ Ich geriet ins Schwitzen. Eine Fortsetzung meiner Dokumentation könnte unter Umständen auch für mich von Vorteil sein. Immerhin belebt Konkurrenz ja bekanntlich das Geschäft und vielleicht beinhaltete diese Geschichte ja Potential für eine Gehaltsverhandlung mit meinem Chef. “Ich habe aber gehört, dass ich mir meine – ähhh – Geschäftspartner aussuchen kann“
In diesem Moment fing die Dame am anderen Ende an, lauthals zu lachen. Meine lieben Kolleginnen kamen um die Ecke und stimmten, ein Telefon am Ohr, in das Gelächter ein. Mittlerweile ging mir ein Licht auf und ich erkannte meine Freundin, die damals ihren zweiten Arbeitstag in unserer Gesellschaft verbracht hatte an dem glucksenden, nach Luft ringenden Röcheln.
Morgen geht es weiter mit „Wie mir Juliette ihre Ohrringe schenkte“.
Kommentare (1 Kommentar) Kommentieren
TEASER
cassandra, Dienstag, 12. Juli 2005, 01:15
Filed under: Erinnerungen
Ich arbeite in einer – nun sagen wir mal – etwas ungewöhnlichen Firma. Ein wenig Sekte, ein wenig Therapiegruppe und ganz viel Familie. Mit den üblichen Zickereien und wir-haben-uns-alle-lieb-Umarmungen, kleinen und großen persönlichen Aussprachen, jeder Menge Klatsch und Tratsch und einem Chef an der Spitze unseres Weiberhaufens.
Hin und wieder gibt es auch andere männliche Angestellte. Die sind jedoch eher klein, schmalbrüstig und Anfang bis Mitte Zwanzig.
Das schlimme an unserer Firma ist, das man nicht wegkommt. Diejenigen, die den Absprung in die weite Welt dort draussen geschafft haben, wollen alle wieder zurück (es sei denn, sie wurden kollektiv vertrieben, weil sie der Familienidylle schadeten und selbst von denen klopfen einige mit dem Versprechen, sich gebessert zu haben, wieder an die Firmentür).
So unterschiedlich ein jeder von uns ist, gibt es doch eine Gemeinsamkeit, die scheinbar Einstellungskriterium ist: Trinkfestigkeit. Unsere Partys sind legendär und wenn wir irgendwo einfallen, erzählt man sich davon noch Jahre später.
Zwei Mal im Jahr erreicht das sündige Partyleben seinen Höhepunkt. Enden tun diese orgastischen Feierlichkeiten in der Regel im Puff.
Zum einen wäre da der alljährliche Besuch der Kirmes an einem Donnerstag, der, nachdem wir auch aus der letzten schlechten Altstadt Diskothek herausgeschmissen werden und auch rein gar nichts mehr geöffnet ist, auf einen kleinen Absacker in zwielichtigen Etablissements endet und zum anderen die Werbefilmfestspiele in Cannes, wo nach 5 Uhr morgens kein Getränk mehr zu erwerben ist.
In den nächsten Tagen möchte ich an dieser Stelle über meine Erlebnisse aus dem Rotlichtmilieu berichtenwas tut man nicht alles für seine Zugriffszahlen.
Also schauen Sie morgen wieder rein und lesen Sie:
„Als ich mit Francesca an der Stange tanzte und weshalb mich mein Chef noch heute auslacht“.
Hin und wieder gibt es auch andere männliche Angestellte. Die sind jedoch eher klein, schmalbrüstig und Anfang bis Mitte Zwanzig.
Das schlimme an unserer Firma ist, das man nicht wegkommt. Diejenigen, die den Absprung in die weite Welt dort draussen geschafft haben, wollen alle wieder zurück (es sei denn, sie wurden kollektiv vertrieben, weil sie der Familienidylle schadeten und selbst von denen klopfen einige mit dem Versprechen, sich gebessert zu haben, wieder an die Firmentür).
So unterschiedlich ein jeder von uns ist, gibt es doch eine Gemeinsamkeit, die scheinbar Einstellungskriterium ist: Trinkfestigkeit. Unsere Partys sind legendär und wenn wir irgendwo einfallen, erzählt man sich davon noch Jahre später.
Zwei Mal im Jahr erreicht das sündige Partyleben seinen Höhepunkt. Enden tun diese orgastischen Feierlichkeiten in der Regel im Puff.
Zum einen wäre da der alljährliche Besuch der Kirmes an einem Donnerstag, der, nachdem wir auch aus der letzten schlechten Altstadt Diskothek herausgeschmissen werden und auch rein gar nichts mehr geöffnet ist, auf einen kleinen Absacker in zwielichtigen Etablissements endet und zum anderen die Werbefilmfestspiele in Cannes, wo nach 5 Uhr morgens kein Getränk mehr zu erwerben ist.
In den nächsten Tagen möchte ich an dieser Stelle über meine Erlebnisse aus dem Rotlichtmilieu berichten
Also schauen Sie morgen wieder rein und lesen Sie:
„Als ich mit Francesca an der Stange tanzte und weshalb mich mein Chef noch heute auslacht“.
Kommentare (0 Kommentare) Kommentieren
MEINE ERSTEN FOLTERERFAHRUNGEN
cassandra, Mittwoch, 4. Mai 2005, 04:55
Filed under: Erinnerungen
Das einzige Foto aus dem Sommer 1985 zeigt eine Gruppe von ca. dreissig 10-12-jährigen frisch gebackenen Thälmannpionieren. Ich stehe in der ersten Reihe. Weisse Brille auf der Nase, die braunen Haare noch kurz vor den Ferien von Mutti in eine topmodische Kochtopffrisur geschnitten, ein rotes Halstuch umgebunden, schaue ich sehr ernst und erwachsen in die Kamera.
Es ist ein riesiges Lager in der Nähe von Rostov-am-Don, voll von 12-Mann Armeezelten mit Doppelstockbetten, in denen unsere Gruppe von deutschen Halbwüchsigen zwischen den sowjetischen Lagerinsassen eine Art VIP Bereich bewohnt. Das Essen ist besser, die Bettdecken weicher und die Regeln weniger streng.
Trotz Sonderstatus dürfen wir um 7 Uhr in der Früh zum Appell und gemeinsamen Frühsport antreten. Meine biologische Uhr tickt jedoch etwas neben der sozialdemokratischen.
Auch an diesem Morgen, dem Morgen vor einer geplanten Exkursion in eine große sowjetische Metropole, verweigere ich die Nahrungsaufnahme zu früher Stunde und setzte mich wort- und genossenschaftsgrußlos in den Bus. Während der vierstündigen Fahrt äussert sich mein passiver Protest durch vollständige Aufmerksamkeitsverweigerung. Ich schlafe durchgängig bis zum Eintreffen in der Vorzeigestadt unseres Bruderlandes und werde unsanft aus meinen Träumen gerissen, als ein Haufen junger Deutscher an mir vorbei in Richtung des vorreservierten Restaurants stürmt. Benommen stolpere ich hinterher. Bereits nach wenigen Schritten übermannt mich eine Welle seltsamer Empfindungen. Sie erinnern an das typische Haar-Schneide-Phänomen.
Die Dinge, die sich in meinem Kopf und Körper abspielen gleichen den Empfindungen, die mich stets im heimischen, engen, heissen Badezimmer, vor der Toilette stehend überkommen, wenn meine Mutter einmal wieder ihren unterdrückten kreativen Impulsen freien Lauf lässt. Die heisse Luft dringt in die Poren der Haut, steigt zum Kopf, sammelt sich dort zu einem kochendem Vulkan, der sämtlich klaren Gedanken in einen Strudel reisst. Das Badezimmer beginnt, sich zu drehen, waberne Dampfwolken zerfliessen zu einem abstrakten Raum, die Stimme meiner Mutter klingt aus weiter Ferne, wie durch Watte zu mir, doch ich kann den Sinn ihrer Worte nicht einordnen.
Die Hitze sucht einen Weg nach draussen, reisst den Mageninhalt mit sich, der ebenfalls den Anschein vermittelt, ausbrechen zu wollen. Die Wellen umspülen den Körper bis sie mit ganzer Kraft über dem Kopf zusammenschlagen und sich der Dampf in Dunkelheit auflöst.
Schnurstracks suche ich im Restaurant die Toilette auf. Doch die gewohnte Umgebung veranlasst meinen Körper nur dazu, sich intensiver der Hitze hinzugeben. Ich wende mich an eine der Aufpasserinnen unserer Gruppe, fasele etwas von Haare schneiden und schwindelig sein und sie empfiehlt mir, mich an ein Fenster zu stellen, um etwas frische Luft zu atmen. Während sich meine Hände an das Fensterbrett klammern, wundere ich mich darüber, dass die draussen vorbeilaufenden Russen schwarze Köpfe haben. Der Rest des Bildes ist hoffnungslos überbelichtet und in blütenreines Weiss getaucht.
Als auch der verbliebene Rest Zeichnung schwindet und in eine sehr lange Weissblende übergeht, entscheide ich mich dafür, dass eine horizontale Position der Situation angemessener erscheint.
Der Notarzt kommt in einem bunten Wagen mit Blaulicht und ich erhalte die erste und bisher letzte Koffeininfusion meines Lebens in meinen Schenkel.
Als ich nach der ärtzlichen Notfallversorgung tatsächlich das Restaurant betrete, lässt sich von der viel-gepredigten Solidarität eines Thälmannpionieres nicht das geringste Anzeichen finden.
Meine kollegialen Mitreisenden liegen in den letzten Zügen des Verzehrs ihrer Nachspeise. Übrig gelassen hat mir niemand etwas.
In den folgenden Stunden hechele ich fröhlich durch sämtliche orthodoxen Kirchen der Stadt, springe fidel die Treppen von Glockentürmen hinauf und balanciere auf alten Mauerresten. Als die Wirkung des Koffeins nachlässt, fühle ich mich plötzlich sehr müde. Nach der vierstündigen Rückfahrt verzichte ich dankend auf das gemeinsame Lagerabendessen und ziehe mich ins Bett zurück.
Einer der Lagerwärter erkundigt sich nach meinem Befinden und besteht darauf, meine Temperatur zu messen. Ich habe leichtes Fieber und friere schrecklich. Es stellt sich heraus, dass mehrere Angehörige meiner deutschen Reisegruppe unter ähnlichen Symptomen leiden und wir werden in die Krankenbaracke verfrachtet. Die Verordnung des Lagerarztes, meine Bettdecke zu entfernen, entspricht wohl der sowjetischen Methode der Körpertemperatursenkung.
Während ich lediglich zähneklappernd und vollkomen übermüdet in meinem Bett liege und leise vor mich hin schimpfe, geht es meinen Genossen wohl wirklich schlecht. Kurz vor Mitternacht werden wir in einen Armee-Pritschenwagen verfrachtet, in dem wir auf Holzbänken zusammengepfercht das nächst gelegene Krankenhaus aufsuchen. Nun war die Sowjetunion vor früher mal sehr gross.
Die Ausmaße werden einem jedoch erst bewusst, wenn man fiebrig zitternd auf einer Holzbank sitzt und mitten in der Nacht zwei Stunden durch die Gegend ruckelt, um zum nächsten Krankenhaus zu gelangen. Ich will nur schlafen. Was gäbe ich in diesem Moment für ein weiches Bett mit einer dicken warmen Decke.
Stattdessen erreichen wir irgendwann unser Ziel und werden in ein Krankenzimmer geführt. Der Raum ist acht Meter lang und zweieinhalb Meter breit. Fünf Betten stehen nebeneinander mit Blick auf eine weißlackierte Holzwand, in die eine große Flügeltür eingelassen ist, die vermutlich zu einem Badezimmer führt. Betten! Weiße Laken und Bettdecken. Ja. Schlafen. Endlich. Wir dürfen uns ausziehen und hinlegen.
Das Zimmer ist geschlechtergemischt und nur von uns Deutschen belegt.
Gegen halb drei betritt eine Gruppe russischer, weißbekittelter Männern den Raum. Sie sprechen mit dem Mädchen, das ganz links, im ersten Bett liegt. Ich kann nicht hören, worüber sie reden, da ich mich im vierten Bett von der Tür entfernt befinde. Das Mädchen steht auf und folgt ihnen durch die Tür zu unseren Füßen in das vermeintliche Badezimmer. Die Tür schliesst sich und wenige Sekunden später hört man ihre Schreie. Sie schreit und weint. Die Müdigkeit ist vergessen. Aufrecht sitzen wir in unseren Betten und starren auf die weiße Flügeltür. Die Schreie und eine Art unterdrücktes Gurgeln dauern ungefähr fünf Minuten an, dann öffnet sich die Tür und sie wird, von den Weißkitteln gestützt, zu ihrem Bett getragen. Sie weint bitterlich und kann nicht reden. Während dessen wird bereits Patient von Bett Nummer zwei in den Raum gezerrt. Das Schauspiel wiederholt sich. Hinter verschlossenen Türen hört man den Jungen schreien, keuchen und weinen. Der Junge neben mir gerät in Panik. „Mit mir machen sie das nicht. Auf keinen Fall. Sie können mich zu nichts zwingen.“ Er hat Tränen in den Augen und als die Männer zurück kommen, um Patient von Bett Nummer zwei zurückzugeleiten und Nummer Drei zum Kommen aufzufordern, reagiert er bockig. Sie greifen seine Arme und er schlägt blind um sich und schreit „Nein, nein, nein, nein.“ Irgendwann geben sie auf und wenden sich mir zu. Ich heule bereits hemmungslos und will dem tapferen Beispiel meines Bettnachbarn folgen. Ich will mich verweigern, stark sein. Was auch immer sie von mir wollen, ich werde standhaft sein. Ich will doch nur schlafen.
Es hat keinen Zweck. Einer der Männer redet auf deutsch auf mich ein. „Es ist zu deinem besten. Es wird nichts passieren. Alles wird gut.“ Ich lasse mich in den Raum schleifen. Die weißen Türen schliessen sich hinter mir. Der Raum in dem ich mich befinde, ist genauso groß wie das Bettenzimmer. Ein lang gezogener Schlauch, jedoch komplett mit Kacheln ausgelegt. Ein Waschbecken, eine Toilette, eine Neonlampe an der Decke. In der Mitte steht ein einzelner Stuhl. Man drückt mich auf selbigen. Die Männer halten meine Arme fest, so dass ich mich nicht bewegen kann. Der Oberweißkittel hält einen Schlauch in der Hand. Er ist in Beschaffendheit und Durchmesser den Wasserschläuchen ähnlich, die meine Eltern zur Bewässerung ihres Gartens benutzen. Ich weiss noch immer nicht, was eigentlich vor sich geht. Der Schlauchträger macht sich an die Arbeit. Während unzählige Hände meinen Mund aufhalten und meine Hände hinter meinem Rücken kreuzen, schiebt er sein Werkzeug in meinen Hals. Ich versuche zu schreien. Als meine Kehle nur noch erstickende Geräusche von sich gibt, kann ich mich befreien und schlage ich mit Händen und Füßen um mich. Doch die anderen Hände sind stärker. Zentimeter für Zentimeter verschwindet das Gummi in meinem Körper. Ich würge. Doch dies reichte wohl nicht aus. Ein Trichter wird auf den Schlauchansatz gesetzt und jemand giesst Wasser aus einer Kanne herein. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Viel kann die ganze Aktion nicht gebracht haben, weil sich relativ wenig verwertbares Material in meinem Magen befindet. Irgendwann liege ich wieder in meinem Bett und während Bett Nummer fünf abgeführt wird und Bett Nummer drei fragt, was denn nun passiert ist, wende ich mich ab und vergrabe meinen Kopf im Kissen. Schlafen. Nur noch schlafen.
Ich bin gerade eingenickt, da rüttelt jemand an meiner Schulter. Eine Schwester sagt mir auf Russisch irgendetwas und winkt wild mit der Hand. Ich stehe auf und folge ihr. In diesem Moment ist alles egal. Es ist mir auch egal, dass ich mich in einem anderen Raum auf ein Bett legen soll und sie sich an meinem Hintern zu schaffen macht. Kurz darauf habe ich einen Schlauch in meinem Darm und Wasser wird mit Hochdruck hineingeblasen. Nichts berührt mich in diesem Moment mehr. Es ist nicht mein Körper, dem dies passiert. Vermutlich bin ich schon lange eingeschlafen und dies ist nur ein aussergewöhnlich realistischer Albtraum.
Am nächsten Morgen geht es mir großartig. Kein 7 Uhr Appell, kein Frühsport. Ich bin ausgeschlafen, fieberlos und aufgelegt, neue Abenteuer zu erfahren. Die anderen hängen inzwischen am Tropf. Fünf weitere meiner Reisegefährten werden im laufe des Tages eingeliefert. Sie haben sich in dem Restaurant in der Großstadt eine schwere Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ich nicht. Ich habe ja an diesem Tag nur Unmengen von Koffein konsumiert. Leider interessiert das niemanden. Ich verbringe noch fünf unglaublich langweilige Tage in einem russischen Krankenhaus. Einmal kommt einer unserer Betreuer uns besuchen. Er bringt Mandarinen mit. Jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, weiß, dass das etwas ganz besonderes ist.
Es ist ein riesiges Lager in der Nähe von Rostov-am-Don, voll von 12-Mann Armeezelten mit Doppelstockbetten, in denen unsere Gruppe von deutschen Halbwüchsigen zwischen den sowjetischen Lagerinsassen eine Art VIP Bereich bewohnt. Das Essen ist besser, die Bettdecken weicher und die Regeln weniger streng.
Trotz Sonderstatus dürfen wir um 7 Uhr in der Früh zum Appell und gemeinsamen Frühsport antreten. Meine biologische Uhr tickt jedoch etwas neben der sozialdemokratischen.
Auch an diesem Morgen, dem Morgen vor einer geplanten Exkursion in eine große sowjetische Metropole, verweigere ich die Nahrungsaufnahme zu früher Stunde und setzte mich wort- und genossenschaftsgrußlos in den Bus. Während der vierstündigen Fahrt äussert sich mein passiver Protest durch vollständige Aufmerksamkeitsverweigerung. Ich schlafe durchgängig bis zum Eintreffen in der Vorzeigestadt unseres Bruderlandes und werde unsanft aus meinen Träumen gerissen, als ein Haufen junger Deutscher an mir vorbei in Richtung des vorreservierten Restaurants stürmt. Benommen stolpere ich hinterher. Bereits nach wenigen Schritten übermannt mich eine Welle seltsamer Empfindungen. Sie erinnern an das typische Haar-Schneide-Phänomen.
Die Dinge, die sich in meinem Kopf und Körper abspielen gleichen den Empfindungen, die mich stets im heimischen, engen, heissen Badezimmer, vor der Toilette stehend überkommen, wenn meine Mutter einmal wieder ihren unterdrückten kreativen Impulsen freien Lauf lässt. Die heisse Luft dringt in die Poren der Haut, steigt zum Kopf, sammelt sich dort zu einem kochendem Vulkan, der sämtlich klaren Gedanken in einen Strudel reisst. Das Badezimmer beginnt, sich zu drehen, waberne Dampfwolken zerfliessen zu einem abstrakten Raum, die Stimme meiner Mutter klingt aus weiter Ferne, wie durch Watte zu mir, doch ich kann den Sinn ihrer Worte nicht einordnen.
Die Hitze sucht einen Weg nach draussen, reisst den Mageninhalt mit sich, der ebenfalls den Anschein vermittelt, ausbrechen zu wollen. Die Wellen umspülen den Körper bis sie mit ganzer Kraft über dem Kopf zusammenschlagen und sich der Dampf in Dunkelheit auflöst.
Schnurstracks suche ich im Restaurant die Toilette auf. Doch die gewohnte Umgebung veranlasst meinen Körper nur dazu, sich intensiver der Hitze hinzugeben. Ich wende mich an eine der Aufpasserinnen unserer Gruppe, fasele etwas von Haare schneiden und schwindelig sein und sie empfiehlt mir, mich an ein Fenster zu stellen, um etwas frische Luft zu atmen. Während sich meine Hände an das Fensterbrett klammern, wundere ich mich darüber, dass die draussen vorbeilaufenden Russen schwarze Köpfe haben. Der Rest des Bildes ist hoffnungslos überbelichtet und in blütenreines Weiss getaucht.
Als auch der verbliebene Rest Zeichnung schwindet und in eine sehr lange Weissblende übergeht, entscheide ich mich dafür, dass eine horizontale Position der Situation angemessener erscheint.
Der Notarzt kommt in einem bunten Wagen mit Blaulicht und ich erhalte die erste und bisher letzte Koffeininfusion meines Lebens in meinen Schenkel.
Als ich nach der ärtzlichen Notfallversorgung tatsächlich das Restaurant betrete, lässt sich von der viel-gepredigten Solidarität eines Thälmannpionieres nicht das geringste Anzeichen finden.
Meine kollegialen Mitreisenden liegen in den letzten Zügen des Verzehrs ihrer Nachspeise. Übrig gelassen hat mir niemand etwas.
In den folgenden Stunden hechele ich fröhlich durch sämtliche orthodoxen Kirchen der Stadt, springe fidel die Treppen von Glockentürmen hinauf und balanciere auf alten Mauerresten. Als die Wirkung des Koffeins nachlässt, fühle ich mich plötzlich sehr müde. Nach der vierstündigen Rückfahrt verzichte ich dankend auf das gemeinsame Lagerabendessen und ziehe mich ins Bett zurück.
Einer der Lagerwärter erkundigt sich nach meinem Befinden und besteht darauf, meine Temperatur zu messen. Ich habe leichtes Fieber und friere schrecklich. Es stellt sich heraus, dass mehrere Angehörige meiner deutschen Reisegruppe unter ähnlichen Symptomen leiden und wir werden in die Krankenbaracke verfrachtet. Die Verordnung des Lagerarztes, meine Bettdecke zu entfernen, entspricht wohl der sowjetischen Methode der Körpertemperatursenkung.
Während ich lediglich zähneklappernd und vollkomen übermüdet in meinem Bett liege und leise vor mich hin schimpfe, geht es meinen Genossen wohl wirklich schlecht. Kurz vor Mitternacht werden wir in einen Armee-Pritschenwagen verfrachtet, in dem wir auf Holzbänken zusammengepfercht das nächst gelegene Krankenhaus aufsuchen. Nun war die Sowjetunion vor früher mal sehr gross.
Die Ausmaße werden einem jedoch erst bewusst, wenn man fiebrig zitternd auf einer Holzbank sitzt und mitten in der Nacht zwei Stunden durch die Gegend ruckelt, um zum nächsten Krankenhaus zu gelangen. Ich will nur schlafen. Was gäbe ich in diesem Moment für ein weiches Bett mit einer dicken warmen Decke.
Stattdessen erreichen wir irgendwann unser Ziel und werden in ein Krankenzimmer geführt. Der Raum ist acht Meter lang und zweieinhalb Meter breit. Fünf Betten stehen nebeneinander mit Blick auf eine weißlackierte Holzwand, in die eine große Flügeltür eingelassen ist, die vermutlich zu einem Badezimmer führt. Betten! Weiße Laken und Bettdecken. Ja. Schlafen. Endlich. Wir dürfen uns ausziehen und hinlegen.
Das Zimmer ist geschlechtergemischt und nur von uns Deutschen belegt.
Gegen halb drei betritt eine Gruppe russischer, weißbekittelter Männern den Raum. Sie sprechen mit dem Mädchen, das ganz links, im ersten Bett liegt. Ich kann nicht hören, worüber sie reden, da ich mich im vierten Bett von der Tür entfernt befinde. Das Mädchen steht auf und folgt ihnen durch die Tür zu unseren Füßen in das vermeintliche Badezimmer. Die Tür schliesst sich und wenige Sekunden später hört man ihre Schreie. Sie schreit und weint. Die Müdigkeit ist vergessen. Aufrecht sitzen wir in unseren Betten und starren auf die weiße Flügeltür. Die Schreie und eine Art unterdrücktes Gurgeln dauern ungefähr fünf Minuten an, dann öffnet sich die Tür und sie wird, von den Weißkitteln gestützt, zu ihrem Bett getragen. Sie weint bitterlich und kann nicht reden. Während dessen wird bereits Patient von Bett Nummer zwei in den Raum gezerrt. Das Schauspiel wiederholt sich. Hinter verschlossenen Türen hört man den Jungen schreien, keuchen und weinen. Der Junge neben mir gerät in Panik. „Mit mir machen sie das nicht. Auf keinen Fall. Sie können mich zu nichts zwingen.“ Er hat Tränen in den Augen und als die Männer zurück kommen, um Patient von Bett Nummer zwei zurückzugeleiten und Nummer Drei zum Kommen aufzufordern, reagiert er bockig. Sie greifen seine Arme und er schlägt blind um sich und schreit „Nein, nein, nein, nein.“ Irgendwann geben sie auf und wenden sich mir zu. Ich heule bereits hemmungslos und will dem tapferen Beispiel meines Bettnachbarn folgen. Ich will mich verweigern, stark sein. Was auch immer sie von mir wollen, ich werde standhaft sein. Ich will doch nur schlafen.
Es hat keinen Zweck. Einer der Männer redet auf deutsch auf mich ein. „Es ist zu deinem besten. Es wird nichts passieren. Alles wird gut.“ Ich lasse mich in den Raum schleifen. Die weißen Türen schliessen sich hinter mir. Der Raum in dem ich mich befinde, ist genauso groß wie das Bettenzimmer. Ein lang gezogener Schlauch, jedoch komplett mit Kacheln ausgelegt. Ein Waschbecken, eine Toilette, eine Neonlampe an der Decke. In der Mitte steht ein einzelner Stuhl. Man drückt mich auf selbigen. Die Männer halten meine Arme fest, so dass ich mich nicht bewegen kann. Der Oberweißkittel hält einen Schlauch in der Hand. Er ist in Beschaffendheit und Durchmesser den Wasserschläuchen ähnlich, die meine Eltern zur Bewässerung ihres Gartens benutzen. Ich weiss noch immer nicht, was eigentlich vor sich geht. Der Schlauchträger macht sich an die Arbeit. Während unzählige Hände meinen Mund aufhalten und meine Hände hinter meinem Rücken kreuzen, schiebt er sein Werkzeug in meinen Hals. Ich versuche zu schreien. Als meine Kehle nur noch erstickende Geräusche von sich gibt, kann ich mich befreien und schlage ich mit Händen und Füßen um mich. Doch die anderen Hände sind stärker. Zentimeter für Zentimeter verschwindet das Gummi in meinem Körper. Ich würge. Doch dies reichte wohl nicht aus. Ein Trichter wird auf den Schlauchansatz gesetzt und jemand giesst Wasser aus einer Kanne herein. An den Rest kann ich mich nicht erinnern. Viel kann die ganze Aktion nicht gebracht haben, weil sich relativ wenig verwertbares Material in meinem Magen befindet. Irgendwann liege ich wieder in meinem Bett und während Bett Nummer fünf abgeführt wird und Bett Nummer drei fragt, was denn nun passiert ist, wende ich mich ab und vergrabe meinen Kopf im Kissen. Schlafen. Nur noch schlafen.
Ich bin gerade eingenickt, da rüttelt jemand an meiner Schulter. Eine Schwester sagt mir auf Russisch irgendetwas und winkt wild mit der Hand. Ich stehe auf und folge ihr. In diesem Moment ist alles egal. Es ist mir auch egal, dass ich mich in einem anderen Raum auf ein Bett legen soll und sie sich an meinem Hintern zu schaffen macht. Kurz darauf habe ich einen Schlauch in meinem Darm und Wasser wird mit Hochdruck hineingeblasen. Nichts berührt mich in diesem Moment mehr. Es ist nicht mein Körper, dem dies passiert. Vermutlich bin ich schon lange eingeschlafen und dies ist nur ein aussergewöhnlich realistischer Albtraum.
Am nächsten Morgen geht es mir großartig. Kein 7 Uhr Appell, kein Frühsport. Ich bin ausgeschlafen, fieberlos und aufgelegt, neue Abenteuer zu erfahren. Die anderen hängen inzwischen am Tropf. Fünf weitere meiner Reisegefährten werden im laufe des Tages eingeliefert. Sie haben sich in dem Restaurant in der Großstadt eine schwere Lebensmittelvergiftung zugezogen. Ich nicht. Ich habe ja an diesem Tag nur Unmengen von Koffein konsumiert. Leider interessiert das niemanden. Ich verbringe noch fünf unglaublich langweilige Tage in einem russischen Krankenhaus. Einmal kommt einer unserer Betreuer uns besuchen. Er bringt Mandarinen mit. Jeder, der in der DDR aufgewachsen ist, weiß, dass das etwas ganz besonderes ist.
Kommentare (4 Kommentare) Kommentieren
VON DIVERSEN VERSUCHEN DES AKTVOLLZUGES
cassandra, Mittwoch, 13. April 2005, 01:37
Filed under: Erinnerungen
Sexuelle Spätzünder behaupten ja gerne, der Grund für Ihr vergleichsweise hohes Alter, in dem der erste Akt vollzogen wurde, läge weniger an mangelnden Gelegenheiten, als vielmehr an dem Wunsch, den perfekten Erstbeischläfer zu finden, den man oder frau über alles liebt und begehrt, um eine dieser stundenwährenden Kerzenschein-Begattungsarien auf blütenweißer, unschuldiger Brokatbettwäsche zu zelebrieren.
Ichrede mich ebenso heraus argumentiere auf ähnliche Weise, sehe mich natürlich nicht als Spätzünder, sondern eher als hoffnungsvolle Romantikerin. Sobald ich in das Alter kam, in dem die Gedanken sich um körperliche Zuwendungen zu drehen begannen, schwor ich mir, den ersten Geschlechtsverkehr mit einem Mann meines Herzens zu vollziehen. Ich gestand mir das Recht zu, danach meinem Trieb hemmungslos zu folgen. Das erste Mal sollte jedoch etwas unvergessliches darstellen.
Diesem löblichen Vorhaben stand leider meine damalige Schüchternheit, eine leidige Begleiterscheinung der Pubertät, im Wege. Es gab viele Männer, die ich in mein Herz schloss. Ich sah, schwärmte, bewunderte aus der Ferne, verzweifelte und litt. Schmachtete still vor mich hin und redete fort an kein Wort mehr mit dem Auserwählten. Er sollte ja nichts von meinen Gefühlen ahnen und MICH erobern. Taten die Herren leider nie, weil ich immer die Flucht ergriff, in der Hoffnung, dass sie mich deshalb umso begehrenswerter wahrnahmen. Unergründlicherweise taten sie es nicht, rannten mir nicht die elterliche Wohnungstür ein und wussten vermutlich noch nicht einmal, wer ich war. Daher ließ ich mich von pickligen, mich nicht interessierenden Buben befummeln und blieb eine eiserne Jungfrau. (Bis zum heutigen Tag. Hach, ein Astrologie-Witz.)
Mit 19 Jahren traf ich Basti. Er war unglaublich putzig, mit wilden Löckchen, einem vondenfüßenhauenden Lächeln, wunderschönen Zähnen und er war ein Computer Freak.
Nach der ersten verplauderten, vollkommen platonischen Nacht, in dem ich ein Glas Rotwein über die Tastatur des väterlichen PCs vergoss, wusste ich, dass ich endlich meinen Entjungferer kennen gelernt hatte. Meine Eltern weilten zu dieser Zeit an den Wochenenden in ihrem Gartenhäuschen und daher beschloss ich, Basti am nächsten Tag in unsere Wohnung zu locken und mich deflorieren zu lassen. Der Vorwand lag auf der Hand.
Er = Computernerd.
Ich = Verursacherin einer rotweindurchtränkten Tastatur und dadurch in Gefahr, vom väterlichen Zornessturm hinweggefegt zu werden.
Wir trafen uns zum Zwecke der Problemanalyse. Die Tastatur war durchaus noch zu gebrauchen. Das Drücken jeder einzelnen Taste verursachte ein Lebenszeichen auf dem Monitor. Nur leider war die Tastatur zu einem Analphabeten mutiert. Jeder Buchstabe verwandelte sich zu einem anderen. Der potentielle Deflorierer schraubte sie auseinander. Gemeinsam wuschen wir jede einzelne der mit Schaltkreisen bedruckten Plastikfolien. Von Zeit zu Zeit berührten sich unsere Finger wie zufällig unter dem Wasserfall, der sich aus dem Hahn ergoss. Blicke suchten und fanden sich. Augenlider senkten sich demütig, die inneren Gefühle verbergen versuchend. Im sanften Licht der Computerarbeitsleuchte saß er neben mir. Ich konnte seinen Atem in meinem Nacken spüren, während ich mit einem Fön die Folien trocknete.
Sobald die Tastatur wieder zusammengebaut war, fielen wir übereinander her, rissen uns die Klamotten vom Leib, knutschten, machten das, was wir beide schon vorab hier und da ausprobiert hatten und versuchten dann, uns zu vereinen. Basti war ebenfalls Jungfrau. Daher vermutete ich anfänglich, dass er ein wenig tollpatschig vorging. Breitbeinig lag ich auf dem Rücken, das Gefühl erwartend, einen fremden Gegenstand in meinem Körper aufzunehmen, doch nichts geschah. Ich eilte ihm daher zu Hilfe, aber...
Es passte einfach nicht. Ein Blick auf seine Körperverlängerung versicherte mir, dass es sich in seinem Fall um keine genetische Abnormalität handelte. Sein Schwanz war angesichts der drei Schwänze, die ich zuvor zu Gesicht bekommen hatte, nicht wesentlich anders anatomisch gebaut. Auf der anderen Seite, hatte ich mir diese drei auch nicht eingeführt und daher hinkte der Vergleich ein wenig.
Die Lektüre diverser Ausführungen von Dr. Sommer hatte mich über die Existenz eines Jungfernhäutchens aufgeklärt. Ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, dass sich ein so kleiner Hautfetzen derart störrisch verhalten würde. Zumal ich davon ausging, eben selbigen bereits einige Jahre vorab beseitigt zu haben.
Wir rüttelten ein wenig, pressten, rieben, stießen, drängelten. Ich versuchte, meine Beckenbodenmuskelatur zu entspannen, während er es sanft und langsam, schnell und kräftig versuchte. Alle Versuche scheiterten kläglich. Einige Stunden später, beschlossen wir, nahtlos zum Nachspiel überzugehen.
In den folgenden drei Wochen wiederholten wir unsere Entjungferungsversuche mit nur mäßigen Erfolg. Ich durfte mir eine gehörige Tracht Beschimpfungen von Seiten meines Vaters anhören, weil das Tippen des „D“s in einem „S“ resultierte und er verräterische rote Weinflecken in der Umgebung seines Heiligtums fand, während Basti sich Millimeter für Millimeter vorkämpfte.
Wir waren bereits auf gefühlte zwei Zentimeter vorgedrungen, als er zur Ostsee zum Zelten fuhr.
Meine Chance war gekommen. Ich konnte die unbefriedigende Erfahrung ad acta legen und freute mich auf eine romantische Entjungferung in der Brandung des Meeres im glitzernden Licht der Sterne und reiste hinterher.
Es wurde ein wunderschöner Abend. Wir durchtanzten die halbe Nacht in einer Open-Air-Diskothek am Strand. Zwei Menschen, die bis über Ihren Horizont hinaus ineinander verliebt waren, sich jeden Augenblick berühren mussten, aus Angst den anderen zu verlieren, nicht mehr vollkommen zu sein.
Irgendwann zogen wir uns an einen etwas ruhigeren Strandabschnitt zurück. Der Sand war noch von der Tagessonne gewärmt, weich und doch hart genug, keine lästigen Krümel unter der Kleidung zu hinterlassen. Die Wellen umschmeichelten sanft unsere Beine. Der Himmel folgte den Regieanweisungen vorbildlich. Ergoss sich in seiner Schwärze mit funkelnden Highlights über uns. Wir küssten einander. Ertranken in der Nähe des anderen. Im Rausch des Begehrens streiften wir uns gegenseitig unsere Kleidung vom Körper. Nach einer schieren Unendlichlichkeit löste er sich von meinen Lippen und sah mich lange an. Er hauchte „Mir ist gerade total schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben.“
Ich hielt ihn im Arm auf dem Weg zurück zum Zeltplatz. Sein Gesicht war fahl. Er murmelte irgendetwas von zu viel Sonne in den letzten Tagen.
Im Zelt angekommen, übergab er sich vor den Eingang des selbigen. Wenn ich mich recht erinnere, wiederholte er dies noch zweimal.
Als wir am nächsten Morgen auf meiner großen grünen Luftmatratze aufwachten, küssten wir uns. Er entschuldigte sich für den Vorabend. Mit großen unschuldigen Augen sah er mich an. Das schlechte Gewissen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ich war ihm nicht böse und um ihm dies deutlich zu machen, küsste ich ihn zurück. Immer wieder und wieder. Mir war egal, dass er nach seinem nächtlichen Unwohlsein keine Möglichkeit gehabt hatte, sich die Zähne zu putzen. Wir sanken zurück auf die Matratze und nach vielen Küssen spürte ich ihn in mir. Komplett.
Ich
Diesem löblichen Vorhaben stand leider meine damalige Schüchternheit, eine leidige Begleiterscheinung der Pubertät, im Wege. Es gab viele Männer, die ich in mein Herz schloss. Ich sah, schwärmte, bewunderte aus der Ferne, verzweifelte und litt. Schmachtete still vor mich hin und redete fort an kein Wort mehr mit dem Auserwählten. Er sollte ja nichts von meinen Gefühlen ahnen und MICH erobern. Taten die Herren leider nie, weil ich immer die Flucht ergriff, in der Hoffnung, dass sie mich deshalb umso begehrenswerter wahrnahmen. Unergründlicherweise taten sie es nicht, rannten mir nicht die elterliche Wohnungstür ein und wussten vermutlich noch nicht einmal, wer ich war. Daher ließ ich mich von pickligen, mich nicht interessierenden Buben befummeln und blieb eine eiserne Jungfrau. (Bis zum heutigen Tag. Hach, ein Astrologie-Witz.)
Mit 19 Jahren traf ich Basti. Er war unglaublich putzig, mit wilden Löckchen, einem vondenfüßenhauenden Lächeln, wunderschönen Zähnen und er war ein Computer Freak.
Nach der ersten verplauderten, vollkommen platonischen Nacht, in dem ich ein Glas Rotwein über die Tastatur des väterlichen PCs vergoss, wusste ich, dass ich endlich meinen Entjungferer kennen gelernt hatte. Meine Eltern weilten zu dieser Zeit an den Wochenenden in ihrem Gartenhäuschen und daher beschloss ich, Basti am nächsten Tag in unsere Wohnung zu locken und mich deflorieren zu lassen. Der Vorwand lag auf der Hand.
Er = Computernerd.
Ich = Verursacherin einer rotweindurchtränkten Tastatur und dadurch in Gefahr, vom väterlichen Zornessturm hinweggefegt zu werden.
Wir trafen uns zum Zwecke der Problemanalyse. Die Tastatur war durchaus noch zu gebrauchen. Das Drücken jeder einzelnen Taste verursachte ein Lebenszeichen auf dem Monitor. Nur leider war die Tastatur zu einem Analphabeten mutiert. Jeder Buchstabe verwandelte sich zu einem anderen. Der potentielle Deflorierer schraubte sie auseinander. Gemeinsam wuschen wir jede einzelne der mit Schaltkreisen bedruckten Plastikfolien. Von Zeit zu Zeit berührten sich unsere Finger wie zufällig unter dem Wasserfall, der sich aus dem Hahn ergoss. Blicke suchten und fanden sich. Augenlider senkten sich demütig, die inneren Gefühle verbergen versuchend. Im sanften Licht der Computerarbeitsleuchte saß er neben mir. Ich konnte seinen Atem in meinem Nacken spüren, während ich mit einem Fön die Folien trocknete.
Sobald die Tastatur wieder zusammengebaut war, fielen wir übereinander her, rissen uns die Klamotten vom Leib, knutschten, machten das, was wir beide schon vorab hier und da ausprobiert hatten und versuchten dann, uns zu vereinen. Basti war ebenfalls Jungfrau. Daher vermutete ich anfänglich, dass er ein wenig tollpatschig vorging. Breitbeinig lag ich auf dem Rücken, das Gefühl erwartend, einen fremden Gegenstand in meinem Körper aufzunehmen, doch nichts geschah. Ich eilte ihm daher zu Hilfe, aber...
Es passte einfach nicht. Ein Blick auf seine Körperverlängerung versicherte mir, dass es sich in seinem Fall um keine genetische Abnormalität handelte. Sein Schwanz war angesichts der drei Schwänze, die ich zuvor zu Gesicht bekommen hatte, nicht wesentlich anders anatomisch gebaut. Auf der anderen Seite, hatte ich mir diese drei auch nicht eingeführt und daher hinkte der Vergleich ein wenig.
Die Lektüre diverser Ausführungen von Dr. Sommer hatte mich über die Existenz eines Jungfernhäutchens aufgeklärt. Ich konnte mir allerdings nicht vorstellen, dass sich ein so kleiner Hautfetzen derart störrisch verhalten würde. Zumal ich davon ausging, eben selbigen bereits einige Jahre vorab beseitigt zu haben.
Wir rüttelten ein wenig, pressten, rieben, stießen, drängelten. Ich versuchte, meine Beckenbodenmuskelatur zu entspannen, während er es sanft und langsam, schnell und kräftig versuchte. Alle Versuche scheiterten kläglich. Einige Stunden später, beschlossen wir, nahtlos zum Nachspiel überzugehen.
In den folgenden drei Wochen wiederholten wir unsere Entjungferungsversuche mit nur mäßigen Erfolg. Ich durfte mir eine gehörige Tracht Beschimpfungen von Seiten meines Vaters anhören, weil das Tippen des „D“s in einem „S“ resultierte und er verräterische rote Weinflecken in der Umgebung seines Heiligtums fand, während Basti sich Millimeter für Millimeter vorkämpfte.
Wir waren bereits auf gefühlte zwei Zentimeter vorgedrungen, als er zur Ostsee zum Zelten fuhr.
Meine Chance war gekommen. Ich konnte die unbefriedigende Erfahrung ad acta legen und freute mich auf eine romantische Entjungferung in der Brandung des Meeres im glitzernden Licht der Sterne und reiste hinterher.
Es wurde ein wunderschöner Abend. Wir durchtanzten die halbe Nacht in einer Open-Air-Diskothek am Strand. Zwei Menschen, die bis über Ihren Horizont hinaus ineinander verliebt waren, sich jeden Augenblick berühren mussten, aus Angst den anderen zu verlieren, nicht mehr vollkommen zu sein.
Irgendwann zogen wir uns an einen etwas ruhigeren Strandabschnitt zurück. Der Sand war noch von der Tagessonne gewärmt, weich und doch hart genug, keine lästigen Krümel unter der Kleidung zu hinterlassen. Die Wellen umschmeichelten sanft unsere Beine. Der Himmel folgte den Regieanweisungen vorbildlich. Ergoss sich in seiner Schwärze mit funkelnden Highlights über uns. Wir küssten einander. Ertranken in der Nähe des anderen. Im Rausch des Begehrens streiften wir uns gegenseitig unsere Kleidung vom Körper. Nach einer schieren Unendlichlichkeit löste er sich von meinen Lippen und sah mich lange an. Er hauchte „Mir ist gerade total schlecht. Ich glaube, ich muss mich übergeben.“
Ich hielt ihn im Arm auf dem Weg zurück zum Zeltplatz. Sein Gesicht war fahl. Er murmelte irgendetwas von zu viel Sonne in den letzten Tagen.
Im Zelt angekommen, übergab er sich vor den Eingang des selbigen. Wenn ich mich recht erinnere, wiederholte er dies noch zweimal.
Als wir am nächsten Morgen auf meiner großen grünen Luftmatratze aufwachten, küssten wir uns. Er entschuldigte sich für den Vorabend. Mit großen unschuldigen Augen sah er mich an. Das schlechte Gewissen stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ich war ihm nicht böse und um ihm dies deutlich zu machen, küsste ich ihn zurück. Immer wieder und wieder. Mir war egal, dass er nach seinem nächtlichen Unwohlsein keine Möglichkeit gehabt hatte, sich die Zähne zu putzen. Wir sanken zurück auf die Matratze und nach vielen Küssen spürte ich ihn in mir. Komplett.
Kommentare (2 Kommentare) Kommentieren
IN UNTERWÄSCHE VOR PUBLIKUM
cassandra, Dienstag, 22. März 2005, 14:19
Filed under: Erinnerungen
Wir wurden damals in der Schule gezwungen, uns zwischen Musik-, Kunst- oder Schauspielunterricht zu entscheiden. Obwohl ich sehr gerne malte, war ich vollkommen talentlos und entschied ich mich auf Grund mangelnder Zuwendung und Anerkennung durch die Kunstlehrerin für meine Kreationen für letzteres.
Das Fach, dass sich offiziell "Darstellendes Spiel" nannte, machte sich neben Schreibübungen (Klausurthema: "Schreibe einen Einakter, der auf Dialogen beruht, bei denen alle gesprochenen Worte mit einem "B" anfangen.") zum Ziel, halbjährlich eine Aufführung auf die Beine zu stellen.
Ich kam damals gerade von einem einjährigen Aufenthalt in Albuquerque, New Mexico zurück und wurde in die elfte Klasse zurückgestuft. Der Schauspielkurs hatte zum Ende des 10. Schuljahres Dürrenmatts "Der Meteor" aufgeführt und wurde auf Grund des großen Erfolges um eine erneute Vorstellung gebeten. Unglücklicherweise hatte eine der Damen den Kurs abgewählt und nun suchte man händeringend nach einem Ersatz. Da mein Geltungs- und Darstellungsdrang in jungen Jahren weitaus stärker ausgeprägt war, sagte ich - ohne zu wissen, worum es eigentlich ging - sofort zu, die Rolle zu übernehmen.
Erst dann beschäftigte ich mich mit dem Stück.
Der Zweiakter spielt durchgehend in der Wohnung des erfolglosen Malers Nyffenschwander. Er malt vorwiegend Bilder seiner leicht vertrottelten und unglaublich naiven Frau Auguste. Eines Tages kreuzt Herr Schwitter auf. Er hat seine Jugend in eben dieser Künstlerbutze verbracht und ist im Laufe der Jahre vom bettelarmen Niemand zum gefeierten Nobelpreisträger aufgestiegen. Eigentlich ist Herr Schwitter gestorben. Er ist gerade im Krankenhaus für klinisch tod erklärt worden. War er aber gar nicht und ist klammheimlich abgehauen, um zum Sterben an den Ort der Unbekümmertheit seiner Jugend zurückzukehren. Er nistet sich gegen Bezahlung im Bett des armen Maler ein und wartet auf sein Ende. Doch statt zu sterben, kommen nun alle möglichen Leute vorbei, um alte Rechnungen zu begleichen und sich zu verabschieden. Seine Frau, seine Geliebte und und und. An das Ende kann ich mich nicht erinnern, weil meine Rolle zu Beginn des zweiten Aktes ihren letzten Auftritt hat. Ich sollte die Auguste spielen. Nicht wirklich kompliziert. Ich renne den ganzen ersten Akt ständig durch alle Szenen und bediene Herrn Schwitter als persönliche Sklavin. Ich sage immer nur, egal, wie absurd seine Forderungen sind: "Jawohl, Herr Schwitter." Auch als er zum Ende des ersten Aktes meine Gesellschaft in seinem Bett fordert. Zu Beginn des zweiten Aktes ist die liebe Auguste (auf Grund des vermutlich erleuchtend guten Geschlechtsverkehrvollzuges - das erfährt man nie, weil in der Zeit der Vorhang geschlossen ist und das Publikum die Gelegenheit bekommt, die Toilette aufzusuchen oder eine Cola zu trinken) zu einer emanzipierten Frau mutiert und trennt sich mittels eines sehr langen, beeindruckenden Monologes von ihrem Versager-Ehemann. Abtritt Auguste.
Den Text hatte ich relativ schnell auswendig gelernt. Sorge und Kopfzerbrechen bereitete mir meine Kostümierung.
Der erste Akt beginnt folgendermaßen:
... An der Staffelei arbeitet in der Badehose der Maler Nyffenschwander an einem Akt. Das Modell, Auguste Nyffenschwander, sein Frau, liegt nackt, mit dem Rücken gegen das Publikum, auf dem Bett. ...“
Nachdem Herr Schwitter auftaucht, zieht sich Auguste einen Morgenmantel über, in dem sie die ersten Akt bewältigt. In der Endszene darf sie dann richtige Kleidung tragen.
Auf mein vorsichtiges Nachfragen erklärte man mir, dass es vollkommen ausgeschlossen ist, dass eine Darstellerin bei einer Schüleraufführung nackt auftreten dürfe. Man einigte sich darauf, dass Herr Nyffenschwander seine Frau nicht vollkommen unbekleidet, sondern in "Unterwäsche" male.
Ich studierte eine Videoaufzeichnung der vorrangegangenen Aufführung und stellte fest, dass ich das Outfit meiner Vorgängerin: Boxershorts, T-Shirt und später einen Frottee-Bademantel, unpassend und prüde fand. Auguste war zwar naiv, aber sich durchaus der Attraktivität ihres Körpers bewusst. Daher entschied ich mich für einen schwarzen Slip und ein schwarzes Spitzenhemdchen, über welche ich später einen roséfarbenden, kurzen Seidenkimono werfen wollte.
Das Klamottenthema war also vorerst geklärt.
Gab es nur noch Problem Nummer 2. Ich schwärmte damals ein wenig für Herrn Schwitter. Warum weiß ich heute nicht mehr, noch kann ich mich an den Namen des zierlichen, verklemmten Bübchens, der nur Computer im Kopf hatte, erinnern. Wir kannten uns aus dem Informatikclub (jeder hat seine dunklen Geheimnisse), ich war jung, unerfahren, mein Vater ein PC-Freak und ich fühlte mich damals zu blassen Computernerds hingezogen. Die psychologische Analyse erspare ich mir an dieser Stelle. Schönundgut, ich mochte Peer (musste jetzt doch mal kurz googlen, weil es mir keine Ruhe ließ), also Herrn Schwitter ganz gerne. Und nun sollte ich mit Herrn Schwitter ins Bett steigen.
Wir haben nie eine Probe durchgeführt, meine Textsicherheit wurde abgehört - und das war es. Ich erhielt keine Möglichkeit, herauszufinden, ob ich mich meinem Outfit gewachsen fühlte oder wie es sich anfühlt, das erste Mal auf einer richtigen Bühne zu stehen.
Plötzlich war sie da, die Aufführung.
Ich bin lampenfiebergeschwängert und erinnerunglos durch die ersten Szenen gestolpert. In Unterwäsche auf dem Bett liegen. Aufstehen. Mantel über. An den richtigen Stellen ein "Jawohl, Herr Schwitter." Ich bilde mir sogar ein, dass es jedes Mal emotionsgefärbt ein wenig anders klang.
Dann kam die entscheidene Szene. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht ganz klar, wieviel Überwindung es kostet, sich vor fremden Menschen auszuziehen.
AUGUSTE: Die Windeln sind aufgelesen.
SCHWITTER: Verriegle die Tür! Hopp!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter. Verriegelt die Tür. Verriegelt.
Er starrt gegen die Fenster.
SCHWITTER: Zieh die Vorhänge zu!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter. Gehorcht.
SCHWITTER: Komm her!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter. Geht ruhig zu ihm.
Draußen beginnt Nyffenschwander an der Türfalle zu klinken.
NYFFENSCHWANDER: Auguste.
SCHWITTER: Näher!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter.
Nyffenschwander klopft.
NYFFENSCHWANDER: Auguste, mach auf!
SCHWITTER: Mich friert.
AUGUSTE: Soll ich den Pelzmantel –
SCHWITTER: Zieh dich aus!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter.
NYFFENSCHWANDER: Aufmachen, Auguste! Aufmachen!
Poltert gegen die Türe.
SCHWITTER: Leg dich zu mir!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter.
Während sie sich auszieht, poltert und rüttelt Nyffenschwander an die Türe.
NYFFENSCHWANDER: Aufmachen! Aufmachen! Der Scheck ist nicht gedeckt.
Blackout.
Vorhang.
Ich glaube, dass jeder einzelne Satz von Auguste, der ja mehr oder weniger eine Wiederholung des vorherigen war, vollkommen anders klang. Ich fühlte, wie die Anspannung bis zur Unerträglichkeit immer mehr anstieg. Ich verspürte von Sekunde zu Sekunde mehr Angst, die Laute wurden kehliger, der Atem kürzer, meine Furcht, in Kürze langsam den Knoten des Gürtels lösen zu müssen, den Seidenstoff über meine Schultern gleiten zu lassen, und die eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Schritte zum Bett zurückzulegen, während sein Blick auf mich gerichtet ist, mich zu ihm zu legen, ließ mich alles um mich herum vergessen. Es gab kein Publikum mehr. Nur zwei Menschen und das Gefühl, sich nackt und schutzlos auszuliefern.
Meine Angst wurde im Publikum vermutlich als sexuelle Spannung interpretiert und half selbiges zu bannen. Ich legte mich neben Herrn Schwitter. Dies war der perfekte Zeitpunkt für den Vorhang, sich zu schließen und dem ersten Akt ein Ende zu setzen.
Doch nichts passierte. Der Vorhang bewegte sich keinen Millimeter. Ich konnte dies recht gut beobachten, denn ich hatte mich aus Furcht vor zu viel Intimität nicht in Richtung Herrn Schwitters gelegt, sondern hinter ihn mit Blick zum Publikum. Er lag Rücken an Rücken mit mir in Blickrichtung Bühne.
Die riesigen dunkelroten Samtvorhänge hingen schwermütig vor sich hin und dachten nicht einmal daran, sich in Bewegung zu setzen. Stattdessen starrte ich in eine Masse von erwartungsvollen Gesichtern. Nichts. Entweder war der schulexterne Theatertechniker, der von Anfang an etwas sehr beunruhigendes an sich hatte eingeschlafen oder er wichste sich fröhlich ins Land der Träume.
Mein Gehirn begann zu rattern. Improvisieren. Richtige Schauspieler würden an dieser Stelle irgendetwas tun, was nicht im Buch steht, aber passt. Das Publikum erwartet, dass Auguste jetzt Sex mit Herrn Schwitter hat. Umdrehen. Rücken an Rücken ist eine eher ungünstige Ausgangsposition. Augustes Rücken verdeckt alles was sie tut, oder vorgibt zu tun. Ein bißchen rummachen. Zeit überbrücken.
Ich konnte mich nicht bewegen. Umdrehen. Nein. Jetzt. Gleich. Vielleicht schließt sich der Vorhang ja jeden Augenblick. Was denkt das Publikum eigentlich gerade? "Na toll. Jetzt habe ich eins fuffzig bezahlt und dachte, jetzt poppen die gleich und nun machen die einen auf umgekehrtes Löffelchen."
Das dachte ich natürlich nicht.
Mir lagen natürlich Herrn Dürrenmatts Motive am Herzen. Wenn das Publikum nicht davon ausging, dass Herr Schwitter und Auguste unglaublichen, entrückenden, lebensverändernden, jenseitsallerirdischenmaßstäbeliegenden Sex hatten, machte mein Monolog zu Beginn des zweiten Aktes überhaupt keinen Sinn mehr.
Ich lag eine Ewigkeit gelähmt in der Gegend rum und überlegte angestrengt, was ich jetzt alles tun MÜSSTE (Herr Schwitter vermutlich ebenfalls, denn er schwitzte nur reglos vor sich hin.), als endlich der schwermütige Samt Erbarmen hatte und sich langsam schloss.
Mein bekleideter Monolog war anschließend vermutlich eines der Glanzlichter meiner Schauspielkarriere. Eine Frau darzustellen, die ihre eigenen Grenzen ausgelotet hatte, fiel überraschend leicht.
Erstaunlich waren die Nachwirkungen meiner ersten Bühnenerfahrung. Mein Mathelehrer, Herr K., der ebenfalls im Publikum saß, und in den ich während der gesamten Schulzeit auf Grund seines unendlichen Wissens und seiner langen Wimpern hoffnungslos verliebt war, wählte mich in einer dieser typischen Abi-Umfragen zur besten Schauspielerin der Abschlußklasse, Michael, der eine Klasse über mir war und in den ich vor meinem Amerikaaufenthalt sehr lange verschossen war, bestürmte mich nach der Aufführung noch wochenlang mit Fragen nach meiner Garderobe ("Sehr mutig. Hast Du das nur für die Rolle getragen, oder ziehst Du dich auch privat so an? ...").
Mit Herrn Schwitter hatte ich danach nicht mehr viel zu tun. Wir unterhielten uns nur über Informatik-bedingte Themen und er verriet mir den einen oder anderen Trick bei Leisure Suit Larry.
Seitdem habe ich mich nie wieder vor Publikum ausgezogen, das mehr als eine Person umfasste.
Das Fach, dass sich offiziell "Darstellendes Spiel" nannte, machte sich neben Schreibübungen (Klausurthema: "Schreibe einen Einakter, der auf Dialogen beruht, bei denen alle gesprochenen Worte mit einem "B" anfangen.") zum Ziel, halbjährlich eine Aufführung auf die Beine zu stellen.
Ich kam damals gerade von einem einjährigen Aufenthalt in Albuquerque, New Mexico zurück und wurde in die elfte Klasse zurückgestuft. Der Schauspielkurs hatte zum Ende des 10. Schuljahres Dürrenmatts "Der Meteor" aufgeführt und wurde auf Grund des großen Erfolges um eine erneute Vorstellung gebeten. Unglücklicherweise hatte eine der Damen den Kurs abgewählt und nun suchte man händeringend nach einem Ersatz. Da mein Geltungs- und Darstellungsdrang in jungen Jahren weitaus stärker ausgeprägt war, sagte ich - ohne zu wissen, worum es eigentlich ging - sofort zu, die Rolle zu übernehmen.
Erst dann beschäftigte ich mich mit dem Stück.
Der Zweiakter spielt durchgehend in der Wohnung des erfolglosen Malers Nyffenschwander. Er malt vorwiegend Bilder seiner leicht vertrottelten und unglaublich naiven Frau Auguste. Eines Tages kreuzt Herr Schwitter auf. Er hat seine Jugend in eben dieser Künstlerbutze verbracht und ist im Laufe der Jahre vom bettelarmen Niemand zum gefeierten Nobelpreisträger aufgestiegen. Eigentlich ist Herr Schwitter gestorben. Er ist gerade im Krankenhaus für klinisch tod erklärt worden. War er aber gar nicht und ist klammheimlich abgehauen, um zum Sterben an den Ort der Unbekümmertheit seiner Jugend zurückzukehren. Er nistet sich gegen Bezahlung im Bett des armen Maler ein und wartet auf sein Ende. Doch statt zu sterben, kommen nun alle möglichen Leute vorbei, um alte Rechnungen zu begleichen und sich zu verabschieden. Seine Frau, seine Geliebte und und und. An das Ende kann ich mich nicht erinnern, weil meine Rolle zu Beginn des zweiten Aktes ihren letzten Auftritt hat. Ich sollte die Auguste spielen. Nicht wirklich kompliziert. Ich renne den ganzen ersten Akt ständig durch alle Szenen und bediene Herrn Schwitter als persönliche Sklavin. Ich sage immer nur, egal, wie absurd seine Forderungen sind: "Jawohl, Herr Schwitter." Auch als er zum Ende des ersten Aktes meine Gesellschaft in seinem Bett fordert. Zu Beginn des zweiten Aktes ist die liebe Auguste (auf Grund des vermutlich erleuchtend guten Geschlechtsverkehrvollzuges - das erfährt man nie, weil in der Zeit der Vorhang geschlossen ist und das Publikum die Gelegenheit bekommt, die Toilette aufzusuchen oder eine Cola zu trinken) zu einer emanzipierten Frau mutiert und trennt sich mittels eines sehr langen, beeindruckenden Monologes von ihrem Versager-Ehemann. Abtritt Auguste.
Den Text hatte ich relativ schnell auswendig gelernt. Sorge und Kopfzerbrechen bereitete mir meine Kostümierung.
Der erste Akt beginnt folgendermaßen:
... An der Staffelei arbeitet in der Badehose der Maler Nyffenschwander an einem Akt. Das Modell, Auguste Nyffenschwander, sein Frau, liegt nackt, mit dem Rücken gegen das Publikum, auf dem Bett. ...“
Nachdem Herr Schwitter auftaucht, zieht sich Auguste einen Morgenmantel über, in dem sie die ersten Akt bewältigt. In der Endszene darf sie dann richtige Kleidung tragen.
Auf mein vorsichtiges Nachfragen erklärte man mir, dass es vollkommen ausgeschlossen ist, dass eine Darstellerin bei einer Schüleraufführung nackt auftreten dürfe. Man einigte sich darauf, dass Herr Nyffenschwander seine Frau nicht vollkommen unbekleidet, sondern in "Unterwäsche" male.
Ich studierte eine Videoaufzeichnung der vorrangegangenen Aufführung und stellte fest, dass ich das Outfit meiner Vorgängerin: Boxershorts, T-Shirt und später einen Frottee-Bademantel, unpassend und prüde fand. Auguste war zwar naiv, aber sich durchaus der Attraktivität ihres Körpers bewusst. Daher entschied ich mich für einen schwarzen Slip und ein schwarzes Spitzenhemdchen, über welche ich später einen roséfarbenden, kurzen Seidenkimono werfen wollte.
Das Klamottenthema war also vorerst geklärt.
Gab es nur noch Problem Nummer 2. Ich schwärmte damals ein wenig für Herrn Schwitter. Warum weiß ich heute nicht mehr, noch kann ich mich an den Namen des zierlichen, verklemmten Bübchens, der nur Computer im Kopf hatte, erinnern. Wir kannten uns aus dem Informatikclub (jeder hat seine dunklen Geheimnisse), ich war jung, unerfahren, mein Vater ein PC-Freak und ich fühlte mich damals zu blassen Computernerds hingezogen. Die psychologische Analyse erspare ich mir an dieser Stelle. Schönundgut, ich mochte Peer (musste jetzt doch mal kurz googlen, weil es mir keine Ruhe ließ), also Herrn Schwitter ganz gerne. Und nun sollte ich mit Herrn Schwitter ins Bett steigen.
Wir haben nie eine Probe durchgeführt, meine Textsicherheit wurde abgehört - und das war es. Ich erhielt keine Möglichkeit, herauszufinden, ob ich mich meinem Outfit gewachsen fühlte oder wie es sich anfühlt, das erste Mal auf einer richtigen Bühne zu stehen.
Plötzlich war sie da, die Aufführung.
Ich bin lampenfiebergeschwängert und erinnerunglos durch die ersten Szenen gestolpert. In Unterwäsche auf dem Bett liegen. Aufstehen. Mantel über. An den richtigen Stellen ein "Jawohl, Herr Schwitter." Ich bilde mir sogar ein, dass es jedes Mal emotionsgefärbt ein wenig anders klang.
Dann kam die entscheidene Szene. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht ganz klar, wieviel Überwindung es kostet, sich vor fremden Menschen auszuziehen.
AUGUSTE: Die Windeln sind aufgelesen.
SCHWITTER: Verriegle die Tür! Hopp!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter. Verriegelt die Tür. Verriegelt.
Er starrt gegen die Fenster.
SCHWITTER: Zieh die Vorhänge zu!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter. Gehorcht.
SCHWITTER: Komm her!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter. Geht ruhig zu ihm.
Draußen beginnt Nyffenschwander an der Türfalle zu klinken.
NYFFENSCHWANDER: Auguste.
SCHWITTER: Näher!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter.
Nyffenschwander klopft.
NYFFENSCHWANDER: Auguste, mach auf!
SCHWITTER: Mich friert.
AUGUSTE: Soll ich den Pelzmantel –
SCHWITTER: Zieh dich aus!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter.
NYFFENSCHWANDER: Aufmachen, Auguste! Aufmachen!
Poltert gegen die Türe.
SCHWITTER: Leg dich zu mir!
AUGUSTE: Jawohl, Herr Schwitter.
Während sie sich auszieht, poltert und rüttelt Nyffenschwander an die Türe.
NYFFENSCHWANDER: Aufmachen! Aufmachen! Der Scheck ist nicht gedeckt.
Blackout.
Vorhang.
Ich glaube, dass jeder einzelne Satz von Auguste, der ja mehr oder weniger eine Wiederholung des vorherigen war, vollkommen anders klang. Ich fühlte, wie die Anspannung bis zur Unerträglichkeit immer mehr anstieg. Ich verspürte von Sekunde zu Sekunde mehr Angst, die Laute wurden kehliger, der Atem kürzer, meine Furcht, in Kürze langsam den Knoten des Gürtels lösen zu müssen, den Seidenstoff über meine Schultern gleiten zu lassen, und die eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Schritte zum Bett zurückzulegen, während sein Blick auf mich gerichtet ist, mich zu ihm zu legen, ließ mich alles um mich herum vergessen. Es gab kein Publikum mehr. Nur zwei Menschen und das Gefühl, sich nackt und schutzlos auszuliefern.
Meine Angst wurde im Publikum vermutlich als sexuelle Spannung interpretiert und half selbiges zu bannen. Ich legte mich neben Herrn Schwitter. Dies war der perfekte Zeitpunkt für den Vorhang, sich zu schließen und dem ersten Akt ein Ende zu setzen.
Doch nichts passierte. Der Vorhang bewegte sich keinen Millimeter. Ich konnte dies recht gut beobachten, denn ich hatte mich aus Furcht vor zu viel Intimität nicht in Richtung Herrn Schwitters gelegt, sondern hinter ihn mit Blick zum Publikum. Er lag Rücken an Rücken mit mir in Blickrichtung Bühne.
Die riesigen dunkelroten Samtvorhänge hingen schwermütig vor sich hin und dachten nicht einmal daran, sich in Bewegung zu setzen. Stattdessen starrte ich in eine Masse von erwartungsvollen Gesichtern. Nichts. Entweder war der schulexterne Theatertechniker, der von Anfang an etwas sehr beunruhigendes an sich hatte eingeschlafen oder er wichste sich fröhlich ins Land der Träume.
Mein Gehirn begann zu rattern. Improvisieren. Richtige Schauspieler würden an dieser Stelle irgendetwas tun, was nicht im Buch steht, aber passt. Das Publikum erwartet, dass Auguste jetzt Sex mit Herrn Schwitter hat. Umdrehen. Rücken an Rücken ist eine eher ungünstige Ausgangsposition. Augustes Rücken verdeckt alles was sie tut, oder vorgibt zu tun. Ein bißchen rummachen. Zeit überbrücken.
Ich konnte mich nicht bewegen. Umdrehen. Nein. Jetzt. Gleich. Vielleicht schließt sich der Vorhang ja jeden Augenblick. Was denkt das Publikum eigentlich gerade? "Na toll. Jetzt habe ich eins fuffzig bezahlt und dachte, jetzt poppen die gleich und nun machen die einen auf umgekehrtes Löffelchen."
Das dachte ich natürlich nicht.
Mir lagen natürlich Herrn Dürrenmatts Motive am Herzen. Wenn das Publikum nicht davon ausging, dass Herr Schwitter und Auguste unglaublichen, entrückenden, lebensverändernden, jenseitsallerirdischenmaßstäbeliegenden Sex hatten, machte mein Monolog zu Beginn des zweiten Aktes überhaupt keinen Sinn mehr.
Ich lag eine Ewigkeit gelähmt in der Gegend rum und überlegte angestrengt, was ich jetzt alles tun MÜSSTE (Herr Schwitter vermutlich ebenfalls, denn er schwitzte nur reglos vor sich hin.), als endlich der schwermütige Samt Erbarmen hatte und sich langsam schloss.
Mein bekleideter Monolog war anschließend vermutlich eines der Glanzlichter meiner Schauspielkarriere. Eine Frau darzustellen, die ihre eigenen Grenzen ausgelotet hatte, fiel überraschend leicht.
Erstaunlich waren die Nachwirkungen meiner ersten Bühnenerfahrung. Mein Mathelehrer, Herr K., der ebenfalls im Publikum saß, und in den ich während der gesamten Schulzeit auf Grund seines unendlichen Wissens und seiner langen Wimpern hoffnungslos verliebt war, wählte mich in einer dieser typischen Abi-Umfragen zur besten Schauspielerin der Abschlußklasse, Michael, der eine Klasse über mir war und in den ich vor meinem Amerikaaufenthalt sehr lange verschossen war, bestürmte mich nach der Aufführung noch wochenlang mit Fragen nach meiner Garderobe ("Sehr mutig. Hast Du das nur für die Rolle getragen, oder ziehst Du dich auch privat so an? ...").
Mit Herrn Schwitter hatte ich danach nicht mehr viel zu tun. Wir unterhielten uns nur über Informatik-bedingte Themen und er verriet mir den einen oder anderen Trick bei Leisure Suit Larry.
Seitdem habe ich mich nie wieder vor Publikum ausgezogen, das mehr als eine Person umfasste.
Kommentare (11 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
